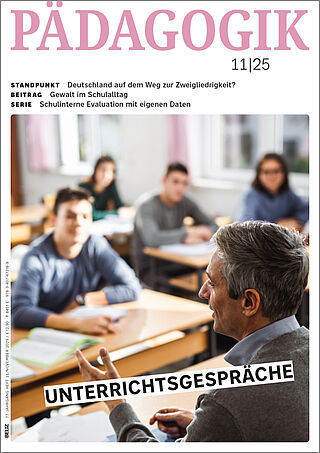- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Thema: Diagnostische Kompetenz
Moderation: Annemarie von der Groeben
Annemarie von der Groeben
Verstehen lernen
Diagnostik als didaktische Herausforderung
Deutschen Lehrerinnen und Leherern fehlt es an diagnostischer Kompetenz. So lautet eines der besonders bedenklichen PISA-Ergebnisse. Worin genau besteht diese Kompetenz und wie erwirbt man sie? Der Einführungsbeitrag geht dieser Frage nach, indem er unterschiedliche Ansätze und Modelle einander gegenüber stellt und die Möglichkeiten einer spezifisch pädagogischen, verstehenden Diagnostik auslotet.
Urs Ruf
Lerndiagnostik und Leistungsbewertung in der Dialogischen Didaktik
Pädagogische Diagnostik zielt auf das Verstehen von Lernprozessen. Das so gewonnene Wissen kann aber nur fruchtbar werden durch ein Wechselspiel zwischen Diagnostik und Didaktik. Das Konzept des Dialogischen Lernens, entwickelt von Urs Ruf und Peter Gallin, basiert auf diesem Prinzip. Der Beitrag schildert an einem Beispiel, wie es angelegt ist und wie es wirksam werden kann.
Susanne Rink
Verstehen, wie sie schreiben
Wie und in welchen Stufen lernen Kinder den schriftlichen Umgang mit unterschiedlichen Textsorten? Dieser Frage ist ein Siegener Forschungsprojekt mit einer einfachen diagnostischen Methode nach gegangen: Grundschulkinder bearbeiteten drei Mal die gleichen Aufgaben im Abstand von je einem Jahr. Es ergaben sich interessante Entwicklungslinien, die oft nicht mit dem übereinstimmen, was Lehrpläne vorsehen.
Helga Pritzkow
Signale wahrnehmen – Verhaltensauffälligkeiten entschlüsseln – Hilfe bieten
Warum fehlt eine Schülerin, die doch im übrigen "gut" ist? Warum ist eine andere trotz brillanter Leistungen so überängstlich? In den meisten Fällen sind solche Verhaltensauffälligkeiten Alarmzeichen oder Hilferufe. Eine Beratungslehrerin berichtet, wie eine vertrauensvolle Gesprächsbeziehung den Blick auf die Ursachen freilegen kann und wie in Schulen wirksame kooperative "Hilfsnetze" aufgebaut werden können.
Katrin Höhmann
Stärken sehen, Förderung planen
Förderpläne als Bausteine einer sinnvollen Begabtenförderung
Ein sprachlich schwacher und mathematisch brillanter Schüler, eine hoch kreative Schülerin, die sich selbst blockiert - Kinder und Jugendliche können ihre Schwächen wirksamer angehen, wenn ihre besonderen Begabungen erkannt und gefördert werden. Der Beitrag schildert, welche Erfahrungen Schulen machen, die diesen Weg gehen und wie sie dabei unterschiedliche diagnostische Instrumente und Verfahren erproben und kombinieren.
Ida Hackenbroch-Krafft, Rainer Schüren
»Woran merke ich denn, ob ich's verstanden habe?«
Diagnose und Förderung von Lesekompetenz zu Beginn der Oberstufe
Schulische Leistungen, so PISA, sind weitestgehend von sprachlichen Kompetenzen abhängig. Eine genaue Diagnose von Grundfähigkeiten im Umgang mit Texten kann helfen, Schwächen auszumachen und Wege für eine gezielte Förderung zu zeigen. Am Bielefelder Oberstufen-Kolleg werden solche Eingangsuntersuchungen regelmäßig durchgeführt. Der Beitrag schildert das Verfahren und die bisherigen Erfahrungen damit.
Michael von Aster
Verstehen, wie sie rechnen
Rechenstörungen sind zumeist leicht erkennbar. Ihre Ursachen sind es nicht. Neurowissenschaftliche Forschungen werfen ein neues Licht auf die Komplexität und Unterschiedlichkeit solcher Störungen, die so medizinisch diagnostizierbar werden. Der Beitrag zeigt, was die Pädagogik von den Nachbarwissenschaften lernen kann und wie Fördermaßnahmen auf solchen diagnostischen Erkenntnissen aufbauen können.
Beitrag
Dorit Bosse, Rudolf Messner
Idole im Leben von Kindern und Jugendlichen
Homogene Lerngruppen bieten bessere Lernvoraussetzungen als heterogene. Diese Kernidee des gegliederten deutschen Schulsystems scheint nahezu unerschütterlich. Wer sie in Frage stellt, riskiert den Schulkampf.Seit TIMMS und PISA wissen wir aber, dass in den Ländern der PISA Spitzengruppe Heterogenität eine selbstverständliche Voraussetzung von Unterricht ist; diese erstaunliche Leistungsfähigkeit integrierter Systeme hat zumindest Fragen aufgeworfen.
Der Beitrag präsentiert Ergebnisse einer Evaluationsstudie, mit der die These belegt wird, dass die Gegenwart leistungsstärkerer SchülerInnen durchgehend zu höheren Lernfortschritten der leistungsschwächeren SchülerInnen führt, ohne dass dies ein Nachteil für die leistungsstärkeren SchülerInnen sein muss. Belegt wird dies am Vergleich der Leistungsentwicklungen von Haupt- und RealschülerInnen in nicht–integrieten und integrierten Systemen.
Serie
Jugend in Bewegung
Folge 4
Olaf Sanders
Jugend und Widerstand
Das Verhältnis von Jugend zur Norm interessiert vor allem die, deren Funktion es ist, der nachwachsenden Generation die Normen nahe zu bringen.
Für Hinweise darauf, wie Jugend sich zur Norm verhält, wird Bezug genommen auf die Shell Studien der letzten Jahre. Aber sobald die Jugend begreifbar erscheint, wird mit ungewohnten Denkformen gegengesteuert.
Letzlich heißt das wieder: Die täglichen Bilder von Jugend mit denen in Beziehung bringen, die Jugend im Großformat abbilden.
Bildungspolitik
Wolfgang Böttcher
Besser werden durch Leistungsstandards? Warum eigentlich nicht?
Eine bildungspolitische Polemik auf empirischem Fundament
Rezensionen
Silvia-Iris Beutel
Reformschulen
Anregungen für einen anderen Schulalltag?
U. a.: Wie lässt sich das Lernen lehren?
Erste Antworten aus dem »Netzwerk innovativer Schulen«
P.S.
Reinhard Kahl’s Kolumne
Lob des Indirekten