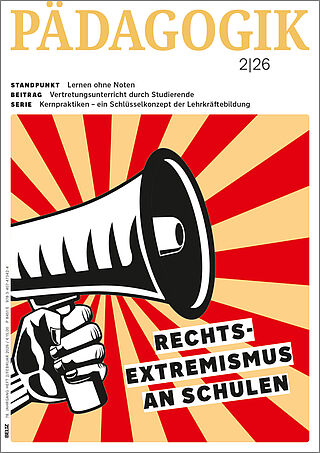- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Kritikfähigkeit
Moderation: Hans Werner Heymann
Hans Werner Heymann
Kritikfähigkeit
Was gehört eigentlich zur »Kritikfähigkeit«? Weshalb ist sie im Rahmen schulischer Bildung unverzichtbar? Handelt es sich eher um eine soziale oder um eine intellektuelle Kompetenz? Wie hängt Kritikfähigkeit mit der Fähigkeit zum kritischen Denken, zum kritischen Vernunftgebrauch zusammen? Welche Rolle spielt Selbstkritik? Und wie schlägt sich Kritikfähigkeit im Handeln nieder? Ein Klärungsversuch.
Frank Schneider, Lothar Pfennig
Förderung von Kritikfähigkeit im Deutschunterricht
Ein dialogischer und strategieorientierter Ansatz
Auf was sollte man achten, wenn man Kritikfähigkeit im Deutschunterricht gezielt fördern möchte? Welche methodischen Arrangements sind geeignet, welche Gesprächs- und Verhaltensregeln hilfreich? Was sind typische Schwierigkeiten, wie lassen sie sich überwinden? Wie wird man unterschiedlichen Altersgruppen gerecht? Lassen sich die hier beschriebenen Erfahrungen auch auf andere Fächer übertragen?
Ulrich Brauner, Timo Leuders
Es ist wahr, denn es steht in der Zeitung …
Mathematik als Mittel der Emanzipation
Mathematik erleben viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene als abstraktes Fach, das mit dem übrigen Leben nur wenig zu tun hat. Wie kann der Mathematikunterricht eine lebenspraktisch bedeutsame Kritikfähigkeit fördern? In den Massenmedien ist ein fehlerhafter und manipulativer Umgang mit Zahlen und Statistiken an der Tagesordnung. Wie können daraus spannende Fragen für den Mathematikunterricht werden?
Annemarie von der Groeben
»Ich denke anders als Kant«
Ethik-Unterricht als Schulung der Urteilskraft
Lassen sich Texte der philosophischen und religiösen Weltliteratur nutzen, um mit Jugendlichen der Jahrgangsstufen 8 bis 10 über ethische Fragen ins Gespräch zu kommen? Sind solche Texte nicht viel zu schwierig für diese Altersgruppe? Wie kann es gelingen, eine Brücke zu schlagen zwischen den Fragen und Problemen heutiger Schülerinnen und Schüler und den Überlegungen und Einsichten großer Denker?
Silvia Greiten
Den Aufbau einer selbstkritischen Haltung fördern
Erfahrungen aus Beratungsgesprächen mit Schülern
Welche Chancen bieten schulische Beratungssituationen, die Kritikfähigkeit von Schülerinnen und Schülern zu stärken? Weshalb fällt es gerade sehr intelligenten Schülern oft schwer, mit den eigenen Gefühlen angemessen umzugehen? Welche Rolle spielt die »emotionale Intelligenz« für die Entwicklung von Kritikfähigkeit? Wie lassen sich Portfolioarbeit und Gruppendiskussionen für ihre Förderung nutzen?
Anne Schmidt-Peters
Kritikfähigkeit im Lehreralltag
Weshalb ist es so wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer kritikfähig sind? In welchen beruflichen Situationen und welchen Personengruppen gegenüber ist ihre Kritikfähigkeit besonders gefordert? Warum ist faire Kritik unter Kollegen so wesentlich? Auf was kommt es beim erfolgreichen Geben und Nehmen von Kritik besonders an? Was können Lehrer tun, um ihre Kritikfähigkeit systematisch weiterzuentwickeln?
Sabine Maschke
Die neue Wachsamkeit
Was Jugendliche kritisch sehen
Was denken heutige Jugendliche über ihr Leben, ihre Zukunft, die Welt im Allgemeinen? Welche Prioritäten setzen sie, welche Ängste und Hoffnungen bewegen sie? Sind sie – wie oft unterstellt wird – im Wesentlichen privatistisch orientiert, politisch desinteressiert und unkritisch? Wie beurteilen sie die Erwachsenen und deren Kompetenz, die drängenden gesellschaftlichen und globalen Probleme zu lösen?
Beitrag
Fritz Haselbeck
Kleine Klassen – gute Lernbedingungen?
Eine qualitative Untersuchung in Hauptschulklassen
Insbesondere von politischer Seite wird gerne behauptet, die Größe einer Klasse hätte keine Auswirkungen auf das Lernen und den Lernerfolg.
Ist solchen Aussagen zuzustimmen? Oder gibt es zwischen großen und kleinen Klassen bedeutsame Unterschiede? Die folgende Zusammenfassung einer empirischen Untersuchung gibt Erfahrungen von Lehrern und Schülern wieder.
Serie
Bildungsforschung und Schule
5. Folge
Ewald Terhart
Was wissen wir über gute Lehrer?
Die Serie Bildungsforschung und Schule wirft in dieser Folge eine klassische Fragestellung auf: Die Frage nach dem guten Lehrer. Was kennzeichnet erfolgreiche Lehrerinnen und Lehrer. Wie sieht das Aufgabenspektrum aus? Welche Bedingungen braucht ein Lehrer, um gut sein zu können? Was leistet die Aus- und Fortbildung?
Der Beitrag von Ewald Terhart zeigt, dass solche Fragen gegenwärtig von der empirischen Bildungsforschung kaum und selten eindeutig beantwortet werden können.
Pädagogik: Kontrovers
Schulleitungen gesondert ausbilden?
Pro: Adolf Bartz
Contra: Stephan G. Huber
Das Leiten von Schule erfordert spezifische Professionalität; deshalb ist es derzeit Konsens, dass das Leiten gelernt werden kann und soll. Streit gibt es über die Frage, wo das Lernen von angehenden Schulleitungen stattfinden soll.
Erwerben angehende Schulleitungen ihre Kompetenzen besser am Arbeitsplatz oder eher in systematischen Ausbildungsgängen? Oder ist eine gelungene Mischung die Lösung?
Die Kontroverse zeigt u.a., dass es wenig gesichertes Wissen zu dieser Frage gibt.
Rezensionen
Nicole Hollenbach
Heterogenität und Schulalltag
Heterogenität erleben Lehrerinnen und Lehrer heute in jeder Schulform, Schulstufe und Schulklasse. Das Problem ist, dass unser gegliedertes System immer noch die Homogenität der Lerngruppe als Ideal suggeriert. So wird der Umgang mit Heterogenität zur Besonderheit.
Die vorgestellten Bücher thematisieren Heterogenität aus unterschiedlichen Perspektiven. Aus sonderpädagogischer und interkultureller Perspektive, aus Sicht der Begabungsförderung sowie der sozialen Ungleichheit ergänzt durch Anregungen für die Unterrichtspraxis.
Magazin
Literaturpädagogik oder: Wenn der Autor vor der Klasse steht • Zahl der Wiederholer rückläufig • Teure Schulabbrecher • Forschen für Bildungsgerechtigkeit • Französisch im Aufwind • Jeder fünfte Schüler zeigt Stress-Symptome • Schüler mit Computer lernen besser • Dänemark hat einen nationalen »Kulturkanon« • Berlin: Elternpartei tritt an • Muster ohne Wert • Abiturnote reicht • Ganztagslehrer(innen) und Ganztagsschulen • Materialien • Termine
P.S.
Reinhard Kahls Kolumne
Etwas liegt in der Luft