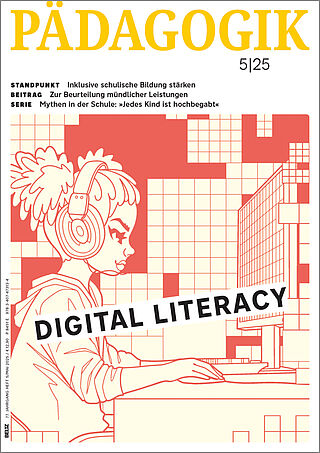- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Vorbilder?
Im Englischen spricht man von »der Welt in der Nussschale«. Dabei dachte man ursprünglich nicht an den Samen, der schon den ganzen Baum enthält, sondern daran, dass ein Teil, so klein, dass es in die Nussschale passt, das Muster des Ganzen, eben die Welt, enthalten kann. Eine moderne Vorstellung, die an die »Selbstähnlichkeit« von Fraktalen in der nacheuklidischen Geometrie (Chaostheorie) erinnert.
Eine pädagogische Welt in der Nussschale hatte ich kürzlich beim Lesen eines Gesprächs in der ZEIT mit Bernhard Bueb und Jesper Juul* vor mir. Es geht um den alltäglichen Kleinkrieg zwischen Erwachsenen und Kindern beziehungsweise Jugendlichen und um die Orientierungslosigkeit der meisten Erwachsenen. Was könnte in Zeiten, in denen die alten Ordnungen des Gehorsams und der weltanschaulichen Gewissheit zerbrochen und neue nicht an ihre Stelle getreten sind – und diese Lücke vielleicht nie mehr geschlossen werden wird – folgen? Die eine Antwort heißt, ein gutes Vorbild sein. Die andere authentisch sein. Fürs Vorbild plädiert Bernhard Bueb. Für die Authentizität tritt Jesper Juul ein. Diese Unterscheidung von Vorbild und Authentizität ist möglicherweise eine, die in die Nussschale passt und eine Welt bedeutet.
Gemeinsam ist Bueb und Juul, dass sich keiner von ihnen mehr auf Normen und Prinzipien verlassen will, die durch Worte, häufig Machtworte, durchgesetzt werden. Dieses ganze unhinterfragbare »Das macht man so« hat seine gesetzgeberische Kraft verloren. Erziehung wirke über Personen, die vorbildlich oder authentisch sind. Ob Vorbild oder Authentizität, dieser Unterschied ist aufschlussreich.
Trojaner?
Bueb sagt, »meine Frau und ich haben immer geglaubt, wenn wir als Vorbild so leben, wie wir es auch von unseren Kindern erwarten, dann werden sie uns schon folgen«. Das klingt nach einem Trojaner, der die richtigen Normen und Prinzipien einschmuggeln soll. Bueb sagt ja nicht, alles hängt in der Erziehung davon ab, wie wir Erwachsene leben. Er zielt auf das Vorbild als spekulativen Effekt, als Mittel zum Erziehungszweck. Geht das? Sind es nicht die Kinder, die diesen Hintersinn sofort spüren und dagegen ihr psychisches Immunsystem aktivieren? »Man spürt die Absicht, und ist verstimmt« (Goethe, später auch bei Wilhelm Busch). Denn wenn das eigene Handeln ethische Maximen durchsetzen soll, dann dürfen diese doch nicht dazu instrumentalisiert werden, ein bestimmtes Verhalten zu bewirken. Ethik ist nie ein Mittel, außer – finden manche – in der Erziehung, weil Kinder ethisch noch nicht voll zurechnungsfähig seien. Aber sind es nicht gerade die Kinder, die auf das inszenierte Vorbild mit ihrer unbestechlichen Frage reagieren, wer bist du wirklich?
Wenn also zum Zweck, ein Vorbild zu sein, der Erwachsene zu einer Verkörperung von Prinzipien wird, die er per Abfärbung durchsetzen will, dann verschwindet er selbst, dann schwindet sein Selbst. Er steht in Gefahr, ein Prinzipien- und Personendarsteller zu werden, also ein wandelnder performativer Widerspruch. Lässt sich ein größerer Gegensatz zum Authentischsein denken?
Unvollkommenheit und Fehler
Bernhard Bueb spricht und schreibt darüber allerdings nicht rein theoretisch oder normativ. Er erwähnt immer wieder sein Scheitern beim Vorbildsein gegenüber seinen Töchtern. Allerdings auf eine sich selbst beschuldigende Art, mit der er den Prinzipien Nachdruck verleiht. Er und seine Frau seien nicht konsequent genug gewesen. Das ist ehrlich und wäre eigentlich ein Gegenargument zum absichtsvollen Vorbild, wenn mit der Selbstbeschuldigung nicht sogleich die Kampfparolen herkömmlicher Erziehung aufheulten: »Grenzen setzen!«, »Konsequent sein!«
Jesper Juul setzt die Maxime »authentisch sein« dagegen. Mit ihr verhält es sich wie mit der Spontanität, sie lässt sich nicht an die Strippe von Befehl und Wirkung nehmen. Authentizität lässt Platz für das Unvollkommene und Würde für das Fehlerhafte, was die Vorbildmacher, erst recht die von konsequent designten Vorlagen aus ihrem Rahmen zu verbannen suchen. Das Konzept Authentizität verschiebt die alte Frage nach dem normativ Gebotenen von »Was ist richtig?« hin zum großen Gespräch »Wie wollen wir leben?«. Das Wie kommt nun vor dem Was. Wichtig wird das Zwischen. »Die Welt ist zwischen den Menschen«, schrieb Hannah Arendt. Ein Individuum kann anders als das »Vorbild« nicht mit sich identisch sein. Nur in seiner inneren Vielfalt und Widersprüchlichkeit kann das Individuum authentisch sein und nur dadurch kann es denken. Denken ist ja nach Platon »das Gespräch zwischen mir und mir selbst«. Wer mit sich identisch ist, braucht dieses Selbstgespräch nicht und braucht auch keine Gespräche mit anderen. Solche faltenlose Identität produziert nach innen und außen Rückkopplungspfeifen. Dann halten sich die Kinder und alle, die Kind geblieben sind, die Ohren zu.
PS
Ein Rat. Jesper Juul lesen! Eine Probe aus dem Interview. »Es gibt viele Eltern, die keine Idee davon haben, was Partnerschaft wirklich sein kann. Sie wollen vor allem eines: ihren Kindern jegliche Niederlage, jeden Schmerz ersparen. Wir nennen sie in Dänemark Curling-Eltern, weil sie jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen versuchen. Aber bei allem Einsatz: Niemand kann ›dem Leben vorbeugen‹. Eltern haben Angst vor Konflikten mit ihren Kindern. Sie wollen vor allem beliebt sein. Das ist tödlich für eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kindern.«
PPS
Kritik, Zustimmung oder Brainstorming: www.redaktion-paedagogik.de
*http://www.zeit.de/2011/44/C-Inteview-Bueb-Juul
Aus: Pädagogik 12/2011