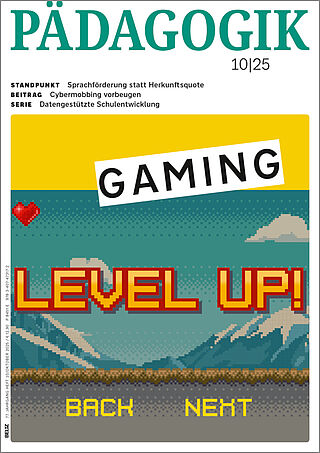- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
PÄDAGOGIK - P.S. Reinhard Kahls Kolumne |
| Tanzen, Singen, Hören |
Der Dirigent hat es zur Weltspitze gebracht. Über Jahre im Voraus ist er ausgebucht. Mitten in einem furiosen Konzert verfärben sich sein Hemd und die weiße Weste. Blut rinnt aus der Nase. Schweißüberströmt bricht der junge Dirigentengott Daniel Dareus zusammen. Er geht daraufhin zurück in sein schwedisches Heimatdorf. Erst mal will er nur noch hören. Vor allem die Stimmen der Natur. Er mietet die alte Schule, in die er selbst gegangen ist. Doch er kann nicht widerstehen, den Kirchenchor zu übernehmen. Und nun erzählt dieser schwedische Film, den dort bereits zwei der acht Millionen Einwohner gesehen haben, eine bezaubernde Geschichte von der Verwandlung dieses Chores. Zunächst klang er so bigott und schräg, wie es dem Klischee eines Kirchenchors entspricht. Man sang immer die richtigen Lieder und sollte als Person zurücktreten. Daniel macht mit den Dorfleuten Entspannungsübungen. Erst mal lässt er die Lieder ganz weg. Die Leute spüren, was es bedeutet einen Körper und eine Stimme nicht nur zu haben, sondern zu sein. So verklumpt mancher Körper schon zu sein scheint, jetzt wird jeder zumindest manchmal schön. In diesem Film erblüht jeder auf eine andere, auf seine Weise, sobald er seinen Ton findet. Das ist die Parabel hinter der Geschichte des Films »Wie im Himmel«: Seinen besonderen, einzigartigen Ton finden und mit anderen zusammen singen! Individualität und Gemeinschaft! Das ist die skandinavische Inspiration. Welcher Himmel? Dabei zeigt der Film durchaus, wo die schwedische Gesellschaft her kommt. Der Pastor erinnert noch an die unerbittliche Prinzipienstrenge des Bischofs in Ingmar Bergmans Film »Fanny und Alexander«, dieser selbstgerechte durch und durch misstrauische Erziehungssadist, der aus seinem Haus ein Überwachungssystem gemacht hat. Aber im Jahr 2005 sagt ein schwedischer evangelischer Bischof über den Film »Wie im Himmel«, er sei »das Wichtigste, was unserer Kirche in jüngster Zeit widerfahren ist.« In der Tat hat der Dirigent Daniel Dareus etwas von einem heutigen Jesus und der ganze Film etwas von einem Neuen Testament. Der Himmel verdunkelt nicht mehr wie bei »Fanny und Alexander« die Erde. Kein kontrollierender, grollender Gott, der jederzeit blitzen kann, wenn die Irdischen seinen allerhöchsten Idealen nicht entsprechen. Der Himmel hängt voller Töne. Aber die müssen empfangen werden. Eine Schlüsselszene zeigt den Unterschied. Die Mitglieder des Kirchenchors verlangen Anweisungen. Der Dirigent soll ihnen sagen, was richtig ist, wie und was sie singen sollen. Der Dirigent als Statthalter des Himmels, wie ehedem auch die Priester und Lehrer. Aber Daniel Dareus weigert sich, Anweisungen zu geben. Er verweist darauf, dass ja alles, was gesucht wird, schon da ist. Die ganze Musik der Welt müsse nur entdeckt werden. »Da oben, überall vibriert sie, und wir können sie holen. Alles geht nur darum, dass wir zuhören, dass wir auch bereit sind, sie von da oben zu holen.« Dafür allerdings muss jeder seine Frequenz finden, beim Empfangen wie beim Senden. Wie oder Was? Der Film ist auch eine Parabel auf Bildung. Nicht nur weil die Folkskola ganz dezent immer im Zentrum steht und der Chor vor dem jähzornigen Pastor und eine Frau vor ihrem Mann in die alte Schule flüchten. Der ganze Film ist eine Partitur im Paradigmenwechsel. Vertrauen Dazu passt der hohe Anteil musischen Unterrichts am finnischen Stundenplan. Dazu passt, dass die Schulaufsicht abgeschafft wurde. Dazu passt, dass Vertrauen groß geschrieben wird. Dazu passt, dass die Evaluation immer weiter ausgebaut wird, aber nicht als ein Angriff des strafenden Gottes erscheint, sondern von den Schulen als Mittel zur Selbsterkenntnis verlangt wird. Das Ziel sei Self Governance, sagt Jarkko Hautamäki, der an der Universität von Helsinki das Evaluationszentrum für Bildung leitet. Das Leben sei eine farbige Angelegenheit. Da gäbe es nichts vorzuschreiben und man könnte Eltern und Lehrern vertrauen, »die haben Augen und ein Gehirn.« Aber sie brauchen Instrumente, Verfahren, gesichertes Wissen und einen kritisch wohlwollenden Blick von außen. P. S. Einer der größten Kinoerfolge in Frankreich war in der letzten Zeit »Die Kinder des Monsieur Mathieu«. Der neue Lehrer verwandelt das deformierte Internat von einem Kriegsschauplatz ebenfalls in einen Chor. Oder »Rhythm Is It«. Der geniale Choreograph Royston Maldoom sagt, »You can change your life in a dance-class« und er zeigt, wie das geht. Man sollte neu darüber nachdenken, was Tanzen, Singen und Hören der Bildung bringt. P.P.S. Kritik, Zustimmung oder Brainstorming: www.reinhardkahl.de |