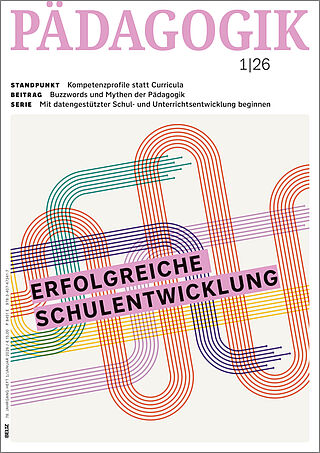- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
PÄDAGOGIK - P.S. Reinhard Kahl’s Kolumne |
| Souveränität |
»An dem Tag, an dem Politiker gut über Lehrer und Lehrer gut über Politiker reden, haben wir in Deutschland eine Bildungsrevolution«, sagte die Stuttgarter Kultusministerin Anette Schavan auf dem ökumenischen Kirchentag in Berlin. Was wäre das für eine Ökumene! Das Ende von ritualisierten Kleinkriegen, Schwarzer-Peter-Spielen und der damit verwandten Wehleidigkeit. Politiker und Lehrer verkörpern diese deutschen Erbsünden, aktiv und passiv. Häufig sind sie auf der Suche nach Schuldigen und müssen selbst als Sündenböcke für alles Mögliche herhalten. Nicht nur darin sind sie verwandt. Beide haben etwas von niederem Klerus. Sie wollen immer noch lieber die Wahrheit vermitteln und Recht haben als Probleme lösen. Sie sind nicht besonders neugierig. Das macht sie so gestrig. Dabei könnte sie etwas anderes verbinden: Grenzgänger sein, unterwegs zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten, zwischen sicherer Vergangenheit und unsicherer Zukunft. Kühn Das setzt bei Lehrern allerdings voraus, dass sie Agenten des Lernens sind und keine Statthalter des Belehrens, dass sie sich als Profis im Schulemachen verstehen, also Schüler unterrichten und nicht Fächer, dass sie ihre Schule kühn konzipieren und alltäglich managen. Lehrer, die sich nicht Historiker oder Mathematiker nennen und tatsächlich Stundengeber sind, mittags schneller im Golf als ihre Schüler auf dem Fahrrad. Dort, wo dieser Wissenschaftsdünkel gar nicht möglich ist, etwa in der Grundschule, gibt es schon deshalb die besseren Lehrer. Vielerorts wird dieser Beruf, der so wunderbar sein kann, neu konzipiert. Zum Beispiel in den USA und Kanada: »The Teacher as a Learner«. Oder in Schweden. Dort ist das Lehrerstudium vor zwei Jahren von den Fundamenten an umgebaut worden. Studenten werden jetzt als »Lernwissenschaftler« ausgebildet. Sie studieren zugleich in der Schule und in der Universität. »Wir wollen nicht mehr die Theorie praktizieren, sondern die Praxis theoretisierten«, sagt Eskil Frank, der Vize-Rektor der Pädagogischen Hochschule Stockholm. Dort sind von künftigen Vorschullehrern bis zu denen, die in der Oberstufe unterrichten werden, alle die ersten Semester zusammen, eben als Lernwissenschaftler. »Und die Besten«, fügt Eskil Frank hinzu, »sollen in die Vorschule gehen.« Professionell Die schwedische Verschränkung von Theorie und Praxis, unter dem Primat der Praxis, die allerdings immer aufklärungsbedürftig ist, sowie das pragmatische, nordamerikanische learning on the job säkularisieren den Beruf. In Deutschland glaubt man häufig immer noch, die hohen Wahrheiten und das gebieterische Wissen seien vom Ideenhimmel abzuseilen. Dann wundert man sich, dass unten so wenig ankommt. Dieter Lenzen hat kürzlich eine Liste »Was ist ein professioneller Lehrer« aufgestellt (Universitas 5, 2003). Dazu gehört auch die Souveränität über das, was ein Lehrer allein kann, was nur mit anderen zusammen gelingt und was nicht geht. Mit dieser Souveränität wird auch die Burn-out-Gefahr weitgehend gebannt. So lässt sich der Falle des Einzelkämpfers, alles zu wollen und wenig zu schaffen, entkommen. Das Geheimnis von Souveränität ist, Herr seiner Ressourcen zu sein und zu wissen, dass sie begrenzt sind. Wie das geht, konnte ich jetzt zwei Wochen lang bei Beobachtungen mit der Kamera in der Helene-Lange-Schule in Wiesbaden erleben. Die Kooperation im Team, vor allem die arbeitsteilige Vorbereitung von Projekten, ist so entlastend, dass die Lehrer im Unterricht eine neue Freiheit erlangen, die des Beobachters. So entsteht eine produktive Distanz, eine ganz andere als die des Priesters, der vor Sündern steht. Projekte, die als Curriculum in der Schule weitergegeben und modifiziert werden, steigern die Binnenkommunikation und damit die Intelligenz der Institution. Eine ähnlich souveräne Professionalität konnte ich in der faszinierenden Jenaplan Schule in Jena erleben. Man erkennt sie übrigens sofort an einer gewissen Eleganz des Lehrkörpers, ja an einem Strahlen in den Gesichtern. Ressourcen Während ich diese hoffnungsvollen Beobachtungen mache, lese ich das Ergebnis einer Studie: »80 Prozent aller Lehrer fühlen sich überfordert.« An welche Abhilfe denken sie? Sie fordern vom Staat Entlastung und von den Eltern andere Kinder. In Baden-Württemberg und Hamburg, wo Lehrer neuerdings mehr arbeiten müssen, beschließen viele Kollegien Dienst nach Vorschrift, streichen Klassenfahrten, Zeit für Gespräche etc. Wann beginnen sie endlich, die Schule zu machen, die sie für richtig und effizient halten? Es wird die beste sein, die sie machen können. Man könnte natürlich immer mehr Ressourcen gebrauchen. Aber solange man den prinzipiellen Mangel nicht akzeptiert, sondern nach oben exportiert, verlagert man dorthin auch seine Souveränität. Nur weil nicht alles geht, muss man sich entscheiden und den Dingen eine Form geben. Aber solange alles von oben zugewiesen wird und in guten wie in schlechten Zeiten mehr Ressourcen eingefordert werden, vermeidet man Entscheidungen, Formen und schließlich sich selbst. Wann beginnen Lehrer endlich, souverän zu werden? P. S. Eine kluge Definition von Souveränität gibt der ansonsten stockkonservative Jurist Carl Schmitt: »Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand gebietet.« An den meisten Schulen, glaube ich, ist das der Hausmeister, oder?
P.P.S. Kritik, Zustimmung oder Brainstorming: Kahl-Lob.des.Fehlers(at)gmx.de |