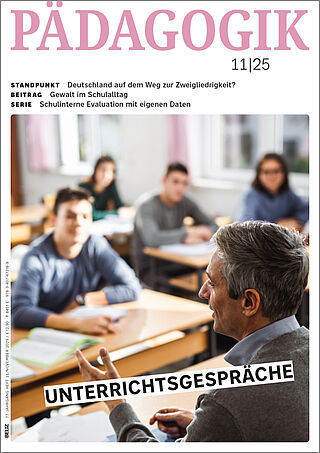- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
PÄDAGOGIK - P.S. Reinhard Kahl’s Kolumne |
| Zusammenspiel |
»Das Gehirn kennt keinen Vorstandsvorsitzenden«, sagt Wolf Singer. Der Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung kann mit »bildgebenden Verfahren« an seinen Computern zeigen, wie Hirnregionen kooperieren. Ein Anweisungen gebendes Zentrum, das mehr weiß als die Teile, die dann bloß Ausführende wären, gibt es nicht. Nein, alles spielt zusammen. Und liegt im Modus dieses Zusammenspiels vielleicht jener Geist, nach dessen Adresse man immer gesucht hat? Das ist eine interessante, neue Musik in der Wissenschaft. Das Gehirn ist viel plastischer, als man bisher glaubte. Sind Teile verletzt, können deren Aufgaben von anderen Regionen übernommen werden. Unterbeschäftigte Areale werden umfunktioniert. Wenn sich Arbeitslosigkeit in der Hirnlandschaft ausbreitet, weil sie mit Anregungen unterversorgt, mit Befehlen überzogen oder gar »zu Boden gelernt« (Jakob Burckhard) worden ist, dann allerdings retardiert das intelligente System. Freiburger Hirnforscher haben Schüler ganze Tage mit Messinstrumenten versehen und herausgefunden, was vor einiger Zeit schon eine kanadische Studie an den Tag brachte: Die Aktivität der Schülerhirne ist vormittags am schwächsten. Liegt das daran, dass in der Schule immer noch die Belehrung durch den großen Vorstandsvorsitzenden bzw. dessen Statthalter verehrt wird? Und wird Lernen eben deshalb vernachlässigt, weil man an das Zentrum glaubt und die Teile nicht achtet? Eine neue Religion Der Glaube an zentrale Steuerung – oder das schlecht gelaunte Opponieren gegen sie, was ja nur die Kehrseite dieser Fixierung ist – zerfällt. Auf allen Ebenen. Könnte Lernen nicht der Name für eine neue, ganz irdische Religion der Selbstorganisation, also des Zusammenspiels und – man verzeihe das Pathos – der Freiheit werden? Diese Idee wird viele Schüler und erst recht die meisten Studenten nicht überzeugen. Ihre Bilder von Lernen sind verwüstet. Wenn man hört, wie Studenten der Wirtschaftswissenschaften oder der Medizin das Wort aussprechen, zumal in ihren examensvorbereitenden »Lerngruppen«, dann kann einem nur das Grausen kommen. Auch vielen Schülern bedeutet Lernen fast ausschließlich, sich einem Zwang zu unterwerfen. Vom erotisierten Wollen wurden sie Jahr für Jahr weiter abgetrieben. Wenig spürt man vom sloterdijkschen »Lernen ist Vorfreude auf sich selbst.« Ein anderer Hirnforscher, der Ulmer Psychiater und Neurobiologe Manfred Spitzer, kann zeigen, woran diese Vorfreude hängt. Je nachdem, ob unter dem Vorzeichen von Angst und Misstrauen oder unter dem von Freude und Anerkennung gelernt wird, nimmt das Gehirn identische Informationen anders auf. Atmosphären Normalerweise verarbeitet der Hippocampus, eine Hirnstruktur im Kortex, die von außen kommenden Informationen. Ist aber Bedrohung im Spiel, laufen sie in den Mandelkern. Dort werden sie mit Angst- und Habacht-Signalen besetzt, damit diese Informationen künftig zur Abwehr oder für Angriffe schnell zur Verfügung stehen. Wird also im Mandelkern Wissen zu Waffen gehärtet, so wird es im Hippocampus eher etwas unscharf und geschmeidig gemacht, damit es langsam mit bisherigem Wissen verwoben und für neue Muster offen gehalten werden kann. Unter Angst und Misstrauen schnell Gelerntes versteift und wird, wenn es nicht gebraucht wird, vergessen. Ein anderes Beispiel für die Bedeutung der Atmosphäre entnimmt der Psychiatrieprofessor, der auch in Philosophie promoviert wurde, der vergleichenden Psychotherapieforschung. Ob Psychoanalyse, Verhaltenstherapie oder bloßes Handauflegen, Therapien seien dann erfolgreich, wenn sich Patient und Therapeut wertschätzten. Sonst scheitere die Kur. Was für Psychotherapeuten zutreffe, gelte allemal für Lehrer. Und dann erzählt der Vater dreier Kinder vom Zynismus und von Erniedrigungen am Schulvormittag. Haarsträubend, was er beim Abendessen so alles zu hören bekommt. Kinder werden in der offiziellen Schule, im Unterricht, isoliert und deaktiviert. In der Pause beginnt die informelle Schule der Peers. Dann leben sie auf und suchen vor allem das eine: Zusammenspiel. Kein Wunder, sagt Spitzer, Menschen sind nicht für die Vereinzelung, sondern für Zusammenarbeit und Zusammenleben geschaffen. Aber Kooperation wird immer noch als eine Art Fahnenflucht vor dem sogenannten spätere Leben bekämpft. »Was die Schule gern übersieht«, fügt er hinzu, »ist, dass Menschen seit Jahrhunderttausenden in Gruppen leben.« Mit anderen Gruppen werde konkurriert, aber in der eigenen und auch mit Nachbarn werde kooperiert. Zusammenarbeit löse schließlich die Ausschüttung von Belohnungen im Gehirn aus. So melde sich das älteste aller Gedächtnisse. P. S. Es zeigt sich immer wieder: Das Wie kommt vor dem Was. Der beste »Stoff«, in den falschen Hals bekommen, nützt nichts oder schädigt. Also muss Bildungspolitik auch Klimapolitik werden. Das wissen manche Pädagogen schon länger. Die Neurobiologie bringt diese Argumente nun unabweisbar auf die Tagesordnung und sie wird gehört. Kürzlich wurde Manfred Spitzer von Schulen und Sparkassen (sic!) nach Schwäbisch Hall zu einem Vortrag über »Lernen« eingeladen. Innerhalb weniger Tage waren die 600 Plätze der Stadthalle verkauft. Die Wiederholungsveranstaltung war erneut überfüllt. P. P. S. Spitzers Buch »Lernen« ist im Spektrum Verlag erschienen. Sein neues Buch »Selbstbestimmen« kommt dort im Oktober heraus. P.P.P.S. Kritik, Zustimmung oder Brainstorming: Kahl-Lob.des.Fehlers(at)gmx.de |