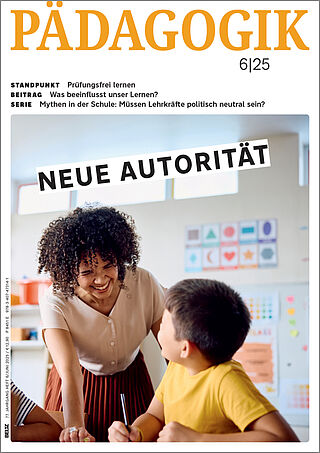- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Methodenkompetenz mit Schülerinnen und Schülern erarbeiten
Möglichkeiten einer individuellen Weiterentwicklung des Unterrichts
Entwicklung von Methodenkompetenz
Dieser Themenschwerpunkt geht von der Beobachtung aus, dass Schülerinnen und Schülern oft grundlegende methodische Fähigkeiten fehlen, ihren Lernprozess halbwegs selbständig und gemeinsam mit anderen zu gestalten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie offensichtlich noch keine Möglichkeit hatten, dies zu lernen.
Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass Lehrerinnen und Lehrer ihren Unterricht (und die Schule) stärker aus der Perspektive des Lernenden gestalten (wollen). Dazu gehört, dass ein solcher Unterricht die Erarbeitung von fachübergreifenden Basiskompetenzen notwendig macht.
Kurz: Eine reflektierte Gestaltung der Lernprozesse durch die Lernenden und die dazu erforderliche Unterstützung des Erwerbs von Lern- und Arbeitstechniken durch die Lehrenden sind heute sowohl gewollt als auch gefordert.
Wie lässt sich angesichts dieses verbreiteten Selbstverständnisses der oben genannte Mangel an grundlegenden methodischen Fähigkeiten erklären? Es gibt Hinweise darauf, dass dieser Anspruch zu selbstverständlich mit dem Anspruch einer systematischen Unterrichts- und Schulentwicklung gleichgesetzt wird. Das ist im Prinzip richtig – und dennoch ist dieses Prinzip nicht anschlussfähig an die Situation all derer, denen der Entwicklungskontext einer solchen Schule fehlt.
In diesem Heft treten wir deshalb bewusst einen Schritt »zurück« und durchdenken den Wunsch nach einer Verbesserung fachübergreifender Basiskompetenzen aus der Perspektive eines einzelnen Lehrenden bzw. eines Lehrerteams, der bzw. das an einer Weiterentwicklung seines Fachunterrichts interessiert ist. Lediglich ein Beitrag dieses Heftes thematisiert, wie dieses Ziel mithilfe eines gemeinsamen Vorgehens erreicht werden kann.
Fachübergreifende Basiskompetenzen
Die Grundlage aller Beiträge dieses Schwerpunkts sind selbstverständlich erprobte Erfahrungen im Fachunterricht; d. h. die Frage der Anbindung an fachliche Zusammenhänge ist Teil des Entstehungskontextes. Gleichwohl werden die Anregungen und Instrumente hier fachunabhängig vorgestellt, um eine Übertragung auf alle Fächer zu ermöglichen.
Was aber verstehen wir unter grundlegenden Methodenkompetenzen bzw. fachübergreifenden Basiskompetenzen? Wir haben uns entschieden, im Sinne eines erweiterten Methodenbegriffs nicht nur das Erlernen grundlegender arbeitsmethodischer Kompetenzen, sondern auch grundlegender sozialer Kompetenzen in den Blick zu nehmen.
Die den Beiträgen unterliegende Systematik von Dimensionen, fachübergreifenden Basiskompetenzen und Methoden zur Entwicklung dieser Kompetenzen wird in Abb. 1 dargestellt.
Die Erfahrungsberichte ordnen diese Kompetenzen ein und führen anhand von methodischen Anregungen und entsprechenden Instrumenten aus, wie die Schülerinnen und Schüler diese Kompetenzen erarbeiten können und wie der Lehrende diese Prozesse unterstützen kann.
Entwicklung von Methodenkompetenz im Kontext von Unterricht und Lernen
Methodenkompetenz ist kein Wert an sich. Der tiefere Sinn dieser Fähigkeiten wird deshalb im Folgenden als Teil eines Verständnisses von Unterricht thematisiert, in der das gemeinsame Lernen an einem Thema mit unterschiedlichen Aneignungsformen verbunden wird, die an den unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen der Lernenden orientiert sind.
Methodenkompetenz und das Verständnis von
Unterricht und Lernen
Wer Anregungen dazu sucht, wie beispielsweise die Fähigkeiten zur Reflexion und Planung des Lernprozesses oder zur eigenständigen Recherche entwickelt werden können, der versteht Unterricht als eine »Koproduktion« von Lehrenden und heterogenen Lerngruppen, als ein Angebot von meist differenzierten Aufgaben und Zugängen, die die Lernenden je nach Interesse und Fähigkeiten nutzen können (sollten).
Ein offenes und gleichzeitig strukturiertes Lernangebot erfordert auf der anderen Seite grundlegende arbeitsmethodische und soziale Fähigkeiten, um solche Lernarrangements erfolgreich nutzen zu können. Problematisch ist es, wenn diese Fähigkeiten nicht systematisch erarbeitet und trainiert, sondern vorausgesetzt werden. Genau an dieser Gelenkstelle zwischen Angebot und Nutzung setzen die Beiträge dieses Heftes an.
Methodenkompetenz und das Verständnis von Aufgaben
Bei offenen und gleichzeitig strukturierten Angeboten sind differenzierende Aufgaben und Materialien die entscheidenden Instrumente, mit denen eine sinnstiftende und effektive (Selbst-)gestaltung des Lernens ermöglicht werden kann. Diese Aufgaben sollten das Ziel haben, die gemeinsame Arbeit an einem Thema mit unterschiedlichen Aneignungsformen zu verbinden (ausführlich dazu von der Groeben 2012).
Für die Seite des Lehrenden bedeutet das, die Aufgaben so zu differenzieren, dass alle Schüler eine für sie passende Zugangsform finden. Für die Seite des Lernenden führt das zu der Frage: Wie können die methodischen Fähigkeiten so entwickelt werden, dass sie diese Herausforderung arbeitsmethodisch und sozial erfolgreich bewältigen können. Auch dazu bieten alle Beiträge grundlegende Hilfen.
Methodenkompetenz mit Blick auf die Lernenden
Beachtet der Blick auf die Lernenden die drei Grundbedürfnisse, wie sie von Decie und Ryen (2000) für erfolgreiches Lernen formuliert wurden, dann werden die Bedürfnisse nach Autonomie, nach Kompetenz und nach sozialer Eingebundenheit berücksichtigt. Auch aus dieser Perspektive wird deutlich, dass Lernen nur befriedigend und erfolgreich gestaltet werden kann, wenn grundlegende methodische Fähigkeiten vorhanden sind.
Das Bedürfnis nach Autonomie kann nur befriedigt werden, wenn ich die Erfahrung mache, dass ich meinen Lernprozess kompetent planen, strukturieren und reflektieren kann.
Das Bedürfnis nach Kompetenz kann nur befriedigt werden, wenn ich dazu in der Lage bin, die notwendigen Informationen kompetent zu beschaffen, zu verarbeiten, sie mündlich oder schriftlich zu präsentieren und so meine Aufgaben erfolgreich bewältigen kann.
Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit wird nur befriedigt, wenn ich die Erfahrung mache, dass ich sowohl gut alleine arbeiten kann als auch zu einem Lernteam gehöre, das ähnliche Ziele und Interessen verfolgt.
Methodenkompetenz und Möglichkeiten der Unterstützung
Die Entwicklung von Methodenkompetenz braucht differenzierte und kontinuierliche Unterstützung. Diese sollte sowohl in den Fachunterricht integriert sein, als auch in separierten Phasen trainiert werden. Wichtig für die langfristige Wirkung ist, dass die kontinuierliche Anwendung von arbeitsmethodischen und sozialen Fähigkeiten Teil der Planung des Fachunterricht ist. Dies kann auch im Verbund mit den Fachkollegen erfolgen.
Zu wenig Beachtung bei der Förderung von Methodenkompetenz findet die Erkenntnis, dass die Einstellungen der Lernenden zu dieser Form des Lernens eine hohe Bedeutung haben. Kurz: Wenn die Lernenden nicht die Erfahrung machen können, dass arbeitsmethodische und soziale Kompetenzen ihnen wirklich beim Lernen helfen, dann wird deren Erarbeitung und Nutzung äußerlich bleiben und damit unwirksam. Eine wirkungsvolle Unterstützung wird deshalb immer auch darauf achten, dass die von den Lehrenden als sinnvoll und notwendig erachtete Methodenkompetenz auch von den Lernenden als sinnvoll erfahren werden kann.
Diese Hinweise zum Kontext der Methodenkompetenz sollten für die Entwicklungsarbeit eines einzelnen Lehrenden genauso gelten, wie für die Entwicklungsarbeit einer Einzelschule. Als Ausblick für diejenigen die sich die Entwicklung von Methodenkompetenz als einen gemeinsamen Prozess an ihrer Schule wünschen, bietet der letzte Beitrag dieses Schwerpunkts einen Einblick in die Erarbeitung und die Potentiale eines Methodencurriculums als Teil des Schulprogramms.
Literatur
- von der Groeben, Annemarie/Kaiser, Ingrid (2012): Werkstatt Individualisierung. Hamburg
- Ryan, R. M./Deci, E. L. (2000): Selfdetermination theorie and the facilitation on intrinsic motivation, social development, and well beeing. In: American Psychologist 55/2000, S. 68 – 78
Dr. Johannes Bastian ist Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Schulpädagogik an der Universität Hamburg – seit 2011 im Ruhestand – und Mitglied der Redaktion von PÄDAGOGIK.
Adresse: Rothenbaumchaussee 11, 20148 Hamburg
E-Mail: bastian(at)uni-hamburg.de
Aus: Pädagogik 3/2015