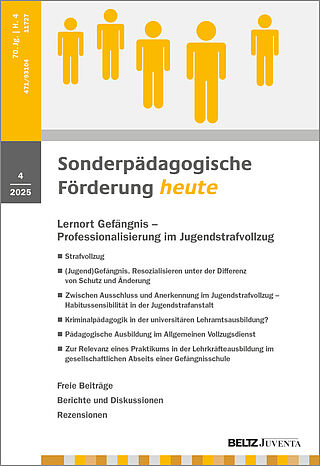- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
»Grenzen des Lebens« – so das Schwerpunktthema dieses Heftes – begegnen uns allenthalben und jeder von uns wird mit ihnen in vielfältiger Weise auch selbst konfrontiert – schon vor dem eigenen Tod. Unter dem Einfluss bioethischer Vorstellungen und auf der Grundlage der Fortschritte in der Medizin, speziell der Pränataldiagnostik, werden sie auch zunehmend künstlich gesetzt.
»Grenzen des Lebens« begegnen uns auch in den Handlungsfeldern der Heil- und Sonderpädagogik von der Frühförderung, über Sonder- bzw. Förderschulen bis hin zu Wohnheimen für behinderte Menschen, aber ebenso bereits am möglichen Beginn des Lebens (vgl. Christian Lindmeier in diesem Heft). Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen, vor allem schweren Behinderungen, und mit chronischen Erkrankungen weisen eine im unmittelbar existenziellen Sinne vergleichsweise höhere Vulnerabilität auf und haben wegen einer fortschreitenden Krankheit häufiger mit einer begrenzten Lebenserwartung zu rechnen.
Ines Nowack schildert als Mutter in einem bewegenden Bericht ihre persönlichen Erfahrungen und die Erfahrungen ihrer Familie im Zusammenleben, Kämpfen und Abschiednehmen von Markus, ihrem 14-jährigen, schwer körperbehinderten Sohn. Sie deutet vieles nur eher vorsichtig an – und gerade darin zeigt sich die Eindrücklichkeit ihrer Schilderungen: die Hoffnungen und das schmerzliche Gewahrwerden der Grenzen des Lebens und der Einflussmöglichkeiten darauf, die Kraftquellen zum Durchhalten, die sich vor allem aus dem gemeinsamen Tragen der Aufgabe in der Partnerschaft und Familie speisen, die Augenblicke geteilter Freude, die Eigensinnigkeit und ›Sturheit‹, den gemeinsamen Lebensweg mit ihrem Sohn bis zum Ende zu gehen, und schließlich die schmerzliche Einsicht, endgültig loslassen und sich verabschieden zu müssen. Die Autorin war sich nicht sicher, ob ein solcher Beitrag einer pädagogischen Fachzeitschrift angemessen sei. Aber wenn man genau liest, sind daraus wertvolle Anregungen zu entnehmen, was Fachleute und Institutionen an guter Hilfestellung für ein Kind mit fortschreitender Erkrankung und seine Familie leisten können.
Besonders in Schulen mit einem hohen Anteil schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher gehört der ›Tod zum Leben‹. Dem versucht eine sich in den letzten Jahren etablierende Thanatopädagogik gerecht zu werden, die – wie Sven Jennessen in seinem Beitrag eingangs festhält – »sowohl die pädagogische Begleitung fortschreitend und lebensbedrohlich erkrankter, sterbender und trauernder Menschen als auch die pädagogische Unterstützung für Menschen zum Gegenstand hat, die auf einer professionellen oder persönlichen Ebene mit Tod konfrontiert sind«.
Sven Jennessen fasst in seinem Beitrag die wichtigsten Ergebnisse seiner quantitativen und qualitativen empirischen Forschungen zum pädagogischen Umgang mit fortschreitender Erkrankung, Sterben und Tod an Förderschulen mit dem Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung zusammen. Anders als in bisherigen körperbehindertenpädagogischen Forschungen steht bei Jennessen die systemische Sicht der schulpädagogischen Auseinandersetzung und nicht die primär personenbezogene Auseinandersetzung mit dieser Thematik im Zentrum des Forschungs- bzw. Erkenntnisinteresses. Durch den an Batesons Systemtheorie orientierten Fokus auf die schulpädagogische Auseinandersetzung mit fortschreitender Erkrankung, Sterben und Tod sind Jennessens Forschungsergebnisse insbesondere unter dem Aspekt der Schulentwicklung und der Etablierung dieser Themen in der Schulkultur gewinnbringend und weiterführend.
Volker Daut berichtet in seinem Beitrag über wichtige Ergebnisse einer qualitativen Studie, in der er 15 (junge) Männer zwischen gut 17 und 38 Jahren über ihr Leben mit einer Duchenne-Muskeldystrophie ausführlich befragte. Darin wird deutlich, dass zwar für sie die Auseinandersetzung mit der verminderten Lebenserwartung, mit Tod und Sterben ein zentrales Thema ihrer Lebensgeschichte und aktuellen Lebenswirklichkeit darstellt, allerdings nicht ständig im Vordergrund steht. Vielmehr werden auch allgemeine Lebensthemen in ihrer besonderen Lebenssituation für sie immer wieder bedeutsam und (be-)drängend, z. B. sich auf ein Leben unter veränderten und eingeschränkten Bedingungen im Rollstuhl einzurichten, die Erfahrungen mit der Umwelt, etwa in der Schule und mit Lehrerinnen und Lehrern. Offenbar – so lässt sich jedenfalls aus den Äußerungen von sechs der Befragten schließen – bilden Beziehungen und Freundschaften mit Mädchen bzw. jungen Frauen, auch wenn sie nicht mehr bestehen, einen bedeutungsvollen Erfahrungsschatz, aus dem sie zehren können. Der Verfasser zeigt eindrucksvoll auf, dass frühzeitige, wahrhaftige und umfassende Informationen über die Erkrankung und ihre Auswirkungen sowie offene Gespräche wichtig und hilfreich sind. Er macht aber zugleich deutlich, dass die Kommunikation mit diesen Kindern und Jugendlichen auch im schulischen Kontext jedoch nicht nur in der Perspektive ihrer verkürzten Lebenserwartung und ihres früher eintretenden Todes zu führen und durchzuhalten ist.
Kinder und Jugendliche mit begrenzter Lebenserwartung pädagogisch zu begleiten stellt Fachpersonen, z. B. Lehrer/innen, daher vor eine nicht leichte, spannungsvolle Aufgabe und Balanceleistung: einerseits im Sinne einer Thanatopädagogik Kindern und Jugendlichen in ihrer existenziellen Bedrängnis vor Tod und Sterben, besonders im ›Angesicht des Todes‹, nicht allein zu lassen, nicht davor zu flüchten, sondern in eine »pädagogische Koexistenz« (Schmeichel) mit ihnen einzutreten und in dieser standzuhalten; andererseits ihnen eine auf Sterben und Tod bezogene Perspektive nicht – unbewusst und subtil – aufzudrängen (Volker Daut stellt dazu abschließend kritische Anfragen), vielmehr offen zu sein für ihre Lebensthemen jenseits von Tod und Sterben, in einer auf Leben und Zukunft gerichteten Perspektive, die ihnen nicht unabsichtlich abgeschnitten werden darf.
Christian Lindmeier / Hans Weiß