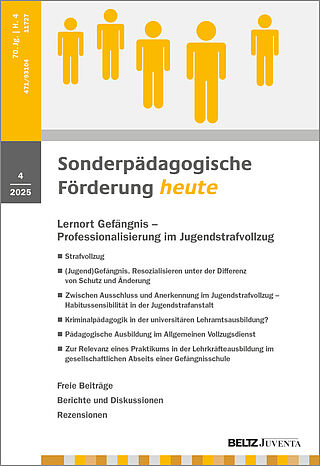- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Liebe Leserinnen und Leser,
der Schritt von der Schule in das Berufsleben bzw. in die Erwerbstätigkeit bedeutet für den Jugendlichen Neu- und Umorientierung, Anstrengung, Leistungsbereitschaft, Herausforderung, aber auch Verunsicherung, Kennen lernen neuer Aufgaben und Anforderungen u.v.m. Wir alle wissen, dass berufliche Tätigkeit weit mehr als »Broterwerb« ist. Mit ihr ist soziale Anerkennung, meist die Einbindung in einer Gruppe sowie Kooperation, Interaktion und Kommunikation mit den Gruppenmitgliedern verbunden. Eine zentrale Funktion von beruflicher Arbeit besteht darin, dass sie den einzelnen über die relativ engen Beziehungen seiner Familie hinaus mit anderen vernetzt, wodurch er in die Gesellschaft eingebunden wird und eine erweiterte Identität gewinnt. Damit wird die gesellschaftliche Dimension der beruflichen Arbeit sichtbar.
Nicht selten erfahren wir von der Isolation Arbeitsloser, die sich vermutlich um ein vielfaches erhöht, wenn der Betroffene/die Betroffene eine Behinderung hat – er/sie ist »besonders« schwer vermittelbar! Soziale Unterstützung durch Gleichbetroffene ist sel-ten möglich, da der nächste/die nächste in vergleichbarer Situation weit weg wohnt.
Mit Problemen und sehr unterschiedlichen Aspekten der beruflichen Rehabilitation setzt sich vorliegendes Heft auseinander.
Den Anspruch auf »Teilhabe an Arbeit« erörtert Horst Biermann in seinem Beitrag. Um Teilhabe an Arbeit zu gewährleisten, wird die berufliche Ausbildung (für alle) ge-fordert. Das Teilhabepostulat ist in Deutschland vor allem durch gesetzliche Vorgaben geregelt. Dabei kann Biermann zeigen, dass zwischen Anspruch und Realität ein erheblicher Widerspruch besteht: So werden Menschen mit Behinderung von Erwerbsarbeit ausgegrenzt oder sie erhalten ihre berufliche Bildung über »Sonderregelungen«, die – bei institutioneller Separierung – dazu beitragen sollen, »in Arbeit zu integrieren«. Diese Wege werden zunehmend hinterfragt. Biermann führt die Diskussion vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt.
Den speziellen Fragestellungen von hochgradig hörgeschädigten jungen Ar-beitnehmern wendet sich Katja Sachsenhauser zu. Sie stellt eine Studie vor, die untersucht, wie junge hörgeschädigte Erwachsene ihre Arbeitssituation nach einigen Jahren Berufstätigkeit wahrnehmen. Ein besonderes Augenmerk richtet sie dabei auf die Arbeitszufriedenheit. In den Ausführungen wird deutlich, dass die Beziehung zu den Kollegen für den hörgeschädigten Arbeitnehmer eine besonders große Rolle spielt. Da soziale Beziehungen von gemeinsamen Interaktionen und gelingender Kommunikation getragen werden, beeinflussen diese die Arbeitszufriedenheit in hohem Maße. In dem Beitrag von Sachsenhauser kommen zahlreiche Betroffene »zu Wort«, was uns deren Situation und deren Empfinden in besonderem Maße veranschaulicht.
Am Beispiel des Berufsbildungswerkes St. Franziskus in Abensberg wird die berufliche Qualifizierung von Menschen mit Autismus vorgestellt. Frank Baumgartner und Matthias Dalferth berichten von der zwölfjährigen Erfahrung in diesem BBW. Dabei arbeiten sie die besonderen Anforderungen, die sich an die berufliche Förderung von Menschen mit Autismus ergeben, besonders heraus. Durch den Verweis auf die Ergebnisse der Modellprojekte »Abklärung der Möglichkeiten zur beruflichen Förderung von Menschen mit autistischen Syndromen und Gewinnung von konkreten Empfehlungen zur Umstellung« und »Teilhabe und berufliche Eingliederung von Men-schen mit Autismus in den ersten Arbeitsmarkt« werden konkrete Hinweise für den Praktiker gegeben.
Wie und ob Schule auf den Beruf vorbereiten kann, wird dann noch mal von Bernd Ahrbeck und Annette Kretschmer unter der Rubik »Diskussion/Berichte« aufgegriffen. Am Beispiel Berliner Schülerfirmen wird der pädagogische Wert – auch im Hinblick auf eine spätere berufliche Eingliederung – aufgezeigt.
Annette Leonhardt / Christian Lindmeier