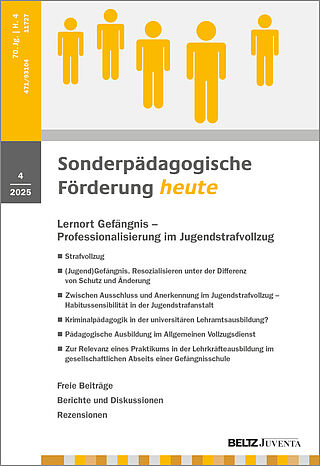- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Liebe Leserinnen und Leser,
nach den Themenschwerpunkten »Inklusion macht Schule« (Heft 4/2008) und »Inklusive Didaktik« (Heft 4/2009) befasst sich auch dieses Heft mit Beiträgen zu einer inklusiven Bildung. Durch das Inkrafttreten der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung im März 2009 haben auch hierzulande fachliche und politische Diskurse an Schubkraft gewonnen, die sich mit der Leitidee eines auf Inklusion ausgerichteten Gesellschafts-, Sozial- und Bildungssystems auseinandersetzen. Diese Leitidee beinhaltet die in der Präambel der Konvention formulierte Hoffnung und Erwartung, »dass die Förderung des vollen Genusses der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen sowie ihrer uneingeschränkten Teilhabe ihr Zugehörigkeitsgefühl verstärken und zu erheblichen Fortschritten in der menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft und bei der Beseitigung der Armut führen wird«.
In dieser Formulierung steckt eine nie ganz einlösbare Vision, ein Stück »utopischer Überschuss«, der Energien zur Umsetzung zu mobilisieren vermag. Um einer am Ziel der Inklusion orientierten Gesellschaft aber wirklich näher zu kommen, bedarf es nüchterner Analysen und Reflexionen, die exkludierende Prozesse wie auch mögliche »Risiken und Nebenwirkungen« einer unbedachten (Schein-)Inklusion kritisch in den Blick nehmen. Erst vor diesem Hintergrund wird im Spannungsfeld zwischen Exklusions- und Inklusionstendenzen eine gehaltvolle und weiterführende Annäherung an die Inklusionsidee möglich sein. Dazu besteht pädagogisch wie bildungspolitisch ein erheblicher Klärungsbedarf. Einige zugespitzte Fragen sollen dies beispielhaft verdeutlichen:
- Wie ist bildungspolitisch damit umzugehen, wenn das staatliche Erziehungs- und Bildungssystem (Kindergarten und Schule) stärker inklusiv ausgerichtet wird, dabei jedoch gleichzeitig – wie durchaus zu beobachten ist – ein wachsendes, quantitativ nicht unerhebliches privates Bildungssystem entsteht, das den Distinktions- und Selbst-Exklusionsbedürfnissen ihrer Eltern- und Schülerschaft »nach oben« gerecht zu werden versucht?
- Wie kann ein inklusives Bildungssystem Kindern und Jugendlichen aus soziokulturell benachteiligten Lebenswelten die notwendige mittelschichtorientierte Allgemeinbildung ermöglichen und sie gleichzeitig für die Bewältigung der »Grenzgänge« zwischen ihrem Herkunftsmilieu und der dominanten Kultur ausstatten?
- Wie können in einem inklusiven Schulsystem Kinder und Jugendliche mit Behinderung so gestärkt werden, dass sie den wohl auch in einem solchen System bei aller Anpassung an individuelle Lern- und Leistungsstrukturen bestehenden Vergleichsdruck mit nicht behinderten Peers unbeschädigt standzuhalten vermögen?
Sich solchen Fragen zu stellen, erscheint uns als eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass das Chancenpotential eines Mehr an Inklusion realistisch wahrgenommen und umgesetzt werden kann. Ihre Beantwortung ist gleichermaßen notwendig, um problematische bildungspolitische Entwicklungen zu vermeiden und unbedachte Scheininklusionen zu minimieren.
Derartigen Fragen stellt sich auch Hans Weiß, wenn er unter Bezug auf Niklas Luhmann Inklusion und Exklusion als mögliche Leitdifferenz des 21. Jahrhunderts betrachtet. Vor dem Hintergrund eines wachsenden Auseinanderdriftens der deutschen Gesellschaft in reich und arm sind derzeit etwa 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche aus Armutsfamilien in der Gefahr, »abgehängt« und exkludiert zu werden. Das spannungsreiche Verhältnis zwischen der Anerkennung von Verschiedenheit und ausgleichender Gerechtigkeit wird deshalb analysiert und diskutiert, ebenso das Spannungsverhältnis von »allgemeiner« und »milieutauglicher« Bildung angesprochen. Überlegungen zur Gestaltung einer nachteilsvermeidenden frühen Bildung schließen sich an.
Teilhabe und Zugehörigkeit sind jedoch nicht nur Leitkategorien der frühen sowie der späteren schulischen Bildung, sie gelten auch für die Berufsausbildung und das Studium. Annette Leonhardt und Marion Honka berichten über die Tsubaku University of Technology (NTUT), die einzige Universität für hör- und sehgeschädigte Studierende in Japan, und darüber, wie in vielfältiger Weise Unterstützungssysteme für diese Personengruppe eingerichtet wurden. Diese Hilfsmittel können auch, davon sind die Autorinnen überzeugt, für hörgeschädigte Studierende in Deutschland sehr hilfreich sein.
Auch außerhalb des Schwerpunktes finden sich Beiträge, die sich mit Problemen des beruflichen Übergangs bzw. Ausbildungsfragen beschäftigen, sei es in einer empirischen Analyse individueller Förderplanung in Berufsbildungswerken (Burkhard Vollmers und Katrin Schulz) oder im Hinblick auf den problematischen Übergang in Ausbildung und Beruf bei lernbehinderten Jugendlichen, dargestellt anhand der Gegebenheiten des Landes Berlin (Annette Kretschmer). Darüber hinaus fragt Eva Knopp nach dem präventiven Stellenwert und der Praktikabilität Curriculumbasierter Verfahren zur Feststellung und Dokumentation der Lernfortschritte von Schülerinnen und Schülern im mathematischen Anfangsunterricht. Die Berichte und Diskussionsbeiträge dieses Heftes sind ebenso wie die Rezensionen so ausgewählt worden, dass sie wichtige Bezüge zum Schwerpunktthema herstellen und zu einer weiterführenden Auseinandersetzung einladen.
Bernd Ahrbeck / Hans Weiß