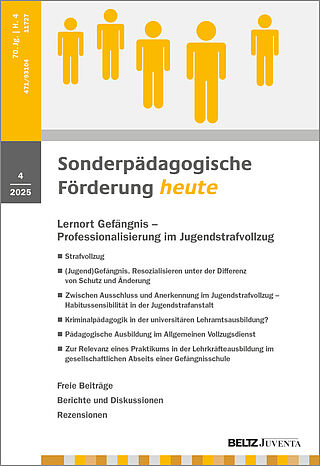- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
das Schwerpunktthema dieses Heftes mutet vielleicht auf den ersten Blick als rein akademisches Thema an; in Wirklichkeit sind die Frage nach dem Nutzen von Kategorisierungen und die Forderung nach Dekategorisierung aber in erster Linie praktisch und politisch motiviert. Der Begriff der Dekategorisierung entstammt nämlich der Debatte um schulische Integration/Inklusion, wo er seit etwa 10 Jahren (in Deutschland) als Kampfformel gegen die mutmaßliche Etikettierung und Stigmatisierung durch bildungspolitische und wissenschaftliche Kategorisierungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen benutzt wird. In diesem Zusammenhang sind nicht nur die früheren Legitimationsbegriffe der ›Behinderung‹ und ›Sonderschulbedürftigkeit‹, sondern jegliche Kategorisierungen in und durch die Bildungspolitik und Wissenschaft – und damit beispielsweise auch der neue bildungspolitische Legitimationsbegriff des ›sonderpädagogischen Förderbedarfs‹ – in die Kritik geraten. Diese Kritik hat in jüngster Zeit durch die Erkenntnistheorie des radikalen Konstruktivismus auch von wissenschaftlicher Seite Unterstützung erhalten. Der Kerngedanke des radikalen Konstruktivismus ist, dass grundsätzlich menschliche Wahrnehmung nicht eine äußere Realität abbildet oder repräsentiert, sondern eine eigene Wirklichkeit erzeugt. Sonderpädagogisch gewendet, kommt eine solche Position – die im Grunde intersubjektive wissenschaftliche Erkenntnis leugnet – beispielsweise zu dem provokativen Schluss, dass die Behinderung im Auge des Betrachters oder Beobachters liege.
Bettina Lindmeier geht deshalb in ihrem Überblick über diese Fachdiskussion sowohl auf die erkenntnistheoretische als auch auf die handlungspraktische und bildungspolitische Dimension der Thematik Dekategorisierung und Kategorisierung in der Sonderpädagogik ein. Ausgehend von der kritischen Analyse der verschiedenen Argumentationsebenen innerhalb dieser facettenreichen und kontroversen Diskussion setzt sie sich im zweiten Teil des Beitrags mit der Frage nach angemessenen Grundbegriffen in der Sonderpädagogik auseinander. Dabei gelangt sie zu der Auffassung, dass die Dekategorisierungsforderung berechtigt ist, soweit es um eine Kategorisierung von Kindern (bzw. Menschen im Allgemeinen) geht. Gleichzeitig vertritt sie die Auffassung, dass eine Beschreibung erschwerter Erziehungs- und Bildungssituationen unverzichtbar ist. Wie sie abschließend an praktischen Beispielen aufzeigt, geht es bei der Kategorisierung von erschwerten Erziehungs- und Bildungssituationen um ›Beschreibungen mittlerer Reichweite‹, die auf einer Zusammenfassung mehrerer Einzelsituationen in einer ›Gesamtsituation‹ beruhen und konkreter sind als eine Formulierung wie beispielsweise ›sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Lernen‹.
Der zweite Beitrag des Thementeils stammt aus Schweiz. Judith Hollenweger demonstriert anhand eigener Forschungsergebnisse aus dem Kanton Zürich, welche Relevanz die neue Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO von 2001 für die Sonderpädagogik hat. Da die ICF nicht nur eine Klassifikation ist, sondern auch ein Modell von ›Behinderung‹, das mit neuen Kategorien operiert, kann sie für einen vertieften Austausch und eine konzeptionelle Analyse der heute in verschiedenen Kontexten angewandten Behinderungskategorien herangezogen werden. Dies demonstriert Judith Hollenweger an den Kategorisierungen von Behinderung in der Sonderpädagogik. Ihre Hauptkritik an drei traditionellen Arten der Kategorisierung in der Sonderpädagogik lautet, dass diese die komplexe Situationsbeschreibung, die durch die ICF geleistet werden kann, in spezifischer Weise verkürzen. Wie sich diese Verkürzungen verhindern lassen, wenn die ICF als Modell und Rahmenklassifikation verwendet wird, demonstriert sie anschließend an zwei Beispielen aus ihrer Forschungspraxis. Dabei handelt es sich zum einen um eine Hochschulstudie, bei der mit Hilfe der ICF die Schwierigkeiten der Studierenden mit und ohne Behinderung analysiert wurden. Zum anderen setzt sich Judith Hollenweger auf der Grundlage der ICF kritisch mit der Relevanz gegenwärtiger förderdiagnostischer Planungsinstrumente und Gutachten in der Sonderpädagogik auseinander. Abschließend geht sie kurz darauf ein, wie mit Hilfe eines auf der ICF basierenden Verfahrens im schulischen Kontext eine Professionalisierung der Teamgespräche und der Förderplanung erreicht werden könnte.
Almut-Hildegard Meyer fasst in ihrem Beitrag die wichtigsten Ergebnisse ihres Buches ›Kodieren mit der ICF: Klassifizieren oder Abklassifizieren?‹ zusammen – allerdings fokussiert auf die Frage, ob sich durch ein differenziertes Klassifikations- und Kodierungssystem wie die ICF-Kategorisierungen, die Personen mit Behinderung ›abklassifizieren‹, vermeiden lassen. Der besondere Wert des Buches wie auch des vorliegenden Beitrags von Almut-Hildegard Meyer liegt zweifellos auch darin, dass die Verfasserin die ICF auch auf sich selbst anwendet. Dies vermag sie, weil sie aufgrund einer neurologischen Bewegungsstörung selbst von einer körperlichen Beeinträchtigung betroffen ist. Almut-Hildegard Meyer leistet mit ihren Arbeiten also auch einen wichtigen Beitrag zu den ›disability studies‹. Hauptergebnis ihrer Studien ist es, dass die ICF gegenüber früheren Klassifikationen aus dem Gesundheitssystem zwar einen großen Forstschritt darstellt, dass sie aber andererseits auch noch eine Reihe von Problemen aufwirft, die in einer anzustrebenden Revision bearbeitet werden sollten. Die Potenzen und die Probleme der ICF werden in ihren Studien so differenziert und gleichzeitig so anschaulich herausgearbeitet, das auch der mit der Materie wenig vertraute Leser schnell einen guten Einblick in das komplexe Gedankengebäude dieser neuen WHO-Klassifikation gewinnen kann.
Jan Weisser geht in seinem Beitrag der Frage nach, inwiefern der Begriff des sonderpädagogischen Förderbedarfs den fachlichen Diskurs in der Sonderpädagogik verändert. Aus diskurstheoretischer Sicht thematisiert er, welche Probleme dieser neue Legitimationsbegriff ungelöst lässt und welche Alternative es zu kategorisierenden Zugriffen dieser Art geben könnte. Als einzige Alternative kommt für ihn in Frage, den sonderpädagogischen Förderbedarf nicht am Kind oder Jugendlichen festzumachen, sondern als Problem der Ungleichheit im Erziehungssystem zu verstehen. Wie sein Versuch einer alternativen theoretischen Rahmung der Sonderpädagogik vor Augen führt, intendiert er mit radikaler Dekategorisierung gerade nicht den völligen Verzicht auf (begriffs-)theoretische Analysen, sondern eine Verlagerung der sonderpädagogischen Zielsetzung und Aufgabenstellung. Thema einer so verstandenen Sonderpädagogik ist die ›heterogenitätstolerante Ungleichheitsbewältigung im Erziehungssystem‹, und ihre Aufgabe die theoretische, praktische und politische Bearbeitung der daraus entstehenden Folgefragen. Dabei ist Jan Weisser vor allem auch daran gelegen, das Konzept des sonderpädagogischen Förderbedarfs in seiner politischen Situierung offen zu legen und die Sonderpädagogik zu einer diskursiven Auseinandersetzung mit der ›politischen Arena‹, in der sie sich bewegt, anzuregen.
Christian Lindmeier