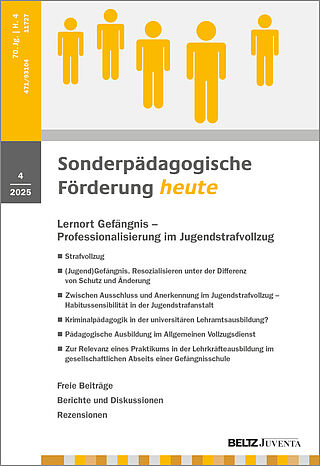- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Liebe Leserinnen und Leser,
Es ist sicher eine bedeutsame Errungenschaft moderner Gesellschaften, dass die Aufgabe, die Bedürfnisse behinderter Menschen nach Schutz, Pflege, Entwicklung und Bildung, sozialer Teilhabe und einem selbstbestimmten Leben unter Beachtung ihres Angewiesenseins auf Hilfe hinreichend gut zu erfüllen, auf verschiedenen Schultern liegt. Was vor allem Eltern und Familien, im Ganzen gesehen, in der Betreuung, Pflege, Sozialisation und Erziehung ihrer behinderter Kinder tagtäglich leisten, zeugt von einem beeindruckenden Engagement und stellt einen Löwenanteil innerhalb der praktizierten gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für (heranwachsende) Menschen mit Behinderung dar. Sie stellen damit die These, dass famililale Solidarpotenziale infolge gesellschaftlicher Individualisierungsprozesse abnehmen, in Frage. Allerdings sind diese Potenziale nicht selbstverständlich, sondern bedürfen der staatlichen und gesellschaftlichen Unterstützung.
Auch das freiwillige Engagement hat in der Hilfe für behinderte Menschen und deren Familien wohl schon immer eine wichtige Rolle gespielt, oftmals auf einer Ebene der »Alltagssolidarität« (H. Keupp) z. B. innerhalb nachbarschaftlicher Kontexte. Als »Ehrenamtliche« engagieren sich Menschen im Sozialraum häufig auch in Verbindung mit Einrichtungen für behinderte und benachteiligte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, sei es in gemeinsamen Freizeitaktivitäten, in Vereinen, in der Alltagsbegleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen während des Übergangs von der Förderschule in die nachschulische Lebenswelt oder in sog. »Unterstützerkreisen« für junge Erwachsene mit geistiger Behinderung. Derartige Aktivitäten freiwilligen Engagements einerseits und professionelle Hilfen andererseits lassen sich nicht gegenseitig substituieren; beide Hilfeformen haben ihre eigene Wertigkeit. Ehrenamtliche können – etwa innerhalb eines Patenschaftsverhältnisses – eine längerfristige Beziehung aufbauen, in der Kontinuität und das Verhältnis von Nähe und Distanz anders gelagert sind als in einer professionellen Beziehung.
Auch die Solidarpotenziale des freiwilligen sozialen Engagements sind nicht voraussetzungslos, sondern bedürfen der »Pflege« und absichernder Strukturen. Institutionen der Behindertenhilfe können Netzwerke aufbauen, in denen Ehrenamtliche ihre Verortung haben. Praktizierte Beispiele von Fördervereinen an Sonder- oder integrativen Schulen zeigen die großen Chancen, die darin bestehen, dass z. B. ehrenamtliche »Paten« auf Zeit eine verlässliche Alltagsbegleitung von (ehemaligen) behinderten oder sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern übernehmen.
Einen ebenfalls zentralen Pfeiler in der nichtprofessionellen Verantwortung für Menschen mit Behinderung stellen – neben elterlich-familiärem und freiwilligem sozialem Engagement – die Betroffenen selbst dar. In mannigfaltigen Selbsthilfeaktivitäten engagieren sich behinderte Menschen im gegenseitigen Informations- und Erfahrungsaustausch, in der gemeinsamen psychosozialen Belastungsverarbeitung sowie in der Interessenvertretung gegenüber Politik, Gesellschaft und speziell auch dem System der Behindertenhilfe. Diese Selbsthilfe- und Selbstvertretungsbewegung hat in Deutschland speziell bei blinden und körperbehinderten Menschen eine Tradition bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts, hat aber im Zuge der Emanzipationsbewegung seit den 60er-Jahren durch internationale Impulse an Verbreitung und Dynamik gewonnen. Viele wichtige Verbesserungen insbesondere auf gesetzlicher Ebene, z. B. Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz, sind wesentlich den Selbstvertretungsaktivitäten behinderter Menschen mit zu verdanken.
Zwischen der professionellen Behindertenhilfe einerseits und den drei genannten Pfeilern nichtprofessionellen Engagements andererseits, aber auch zwischen diesen drei Bereichen bestehen oftmals Spannungsverhältnisse. Diese beruhen auf »natürlichen« Wahrnehmungs- und Interessenunterschieden, zum Teil auf Berührungsängsten, mitunter auch unzureichendem (wechselseitigem) Vertrauen. Solche Spannungspotentiale dürfen nicht ignoriert werden, sondern bedürfen der Bearbeitung in einer Diskurs- und Konfliktkultur. Darin gerade liegen die großen Chancen einer spannungsvollen und zugleich spannenden Zusammenarbeit und solidarischen Bündelung von je spezifischen Expertenpotenzialen. Dazu soll auch dieses Heft beitragen, in dem neben zwei Wissenschaftlern auch betroffene »Beteiligte« selbst zu Wort kommen: die Mutter eines erwachsenen Sohnes mit Down-Syndrom und ein Mann mit Körperbehinderung, der zugleich Behindertenbeauftragter eines Bundeslandes ist.
Ebenso wie das freiwillige Engagement in der »Bürgergesellschaft« steht – so Paul-Stefan Roß – auch die Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft in der Aufmerksamkeit der derzeitigen gesellschaftspolitischen Diskurse. Zwischen beiden Leitideen arbeitet er wichtige inhaltliche Schnittstellen heraus. Dabei wird überzeugend deutlich, dass die Umsetzung gesellschaftlich-kultureller Teilhabe auf das Engagement möglichst vieler Bürger/innen angewiesen ist. Dies verlange eine Weiterentwicklung des Verhältnisses von Staat, professioneller Behindertenhilfe und Bürgeraktivitäten auf der Grundlage von Begegnung, Auseinandersetzung und kritischem Dialog, also »gemeinsamer ›zivil‹ durchrungener Verständigungsprozesse«.
Selbsthilfe und Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen – so die These von Eric Weber – stellen wechselseitige Herausforderungen in der Kooperation und Kommunikation von »Betroffenen« und professionell Handelnden dar. Die damit verbundenen Herausforderungen werden historisch am Beispiel der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und aktuell und perspektivisch am Beispiel der Selbstvertretung im Netzwerk People First Deutschland e. V. beschrieben, wobei aus machttheoretischer Perspektive als zentrales Dilemma der Umgang mit Selbst- und Fremdbestimmung herausgearbeitet wird.
Ausgehend von dem Hauptanliegen der »klassischen« Selbsthilfe zeigt Rainer Kluge aus der Betroffenensicht organisatorisch-strukturelle, zielbezogene und inhaltliche Weiterentwicklungen der Behindertenselbsthilfe auf. Kritisch diskutiert werden die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements nichtbehinderter Menschen für behinderte Menschen sowie das Verhältnis von Menschen mit Behinderung zur Behindertenhilfe, zur Rehabilitation und zur Sonderpädagogik. Auch für Kluge ist die Behindertenbewegung »bei der Gestaltung eines sozialen Bürgerstaates« unverzichtbar.
Maren Müller-Erichsen zeigt in ihrem Beitrag, welche Erfahrungen Eltern behinderter Kinder zur Gründung von Selbsthilfegruppen und -verbänden wie der Lebenshilfe veranlassen. Der Wandel dieser Gruppen zu großen Selbsthilfeorganisationen, in denen engagierte Eltern zu (Non-Profit-)Unternehmern werden und zahlreiche Mitarbeiter/innen in Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe beschäftigen und selbst qualifizieren, wird von Müller-Erichsen am Beispiel ihres eigenen Wirkens bei der Lebenshilfe Gießen e.V. nachgezeichnet. Dabei wird deutlich, welch großen Einfluss solche Organisationen auf die unterschiedlichen Ebenen einer Politik im Interesse behinderter Menschen nehmen können.
Dieses Heft versteht sich als ein Beitrag für den von den Autoren geforderten kritischen Dialog.