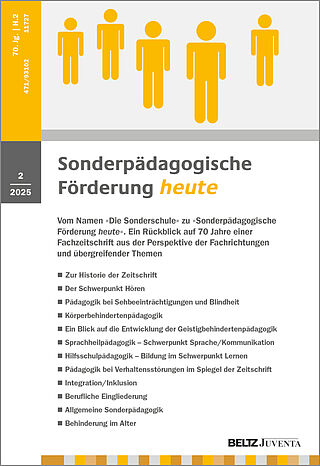- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Liebe Leserinnen und Leser,
Aus konstruktivistischer Perspektive werden Lernen als individueller Konstruktionsprozess und Erkenntnis der Wirklichkeit als selbst-aktive Aneignungsleistung betrachtet. Dementsprechend besteht die Aufgabe der Lehrerin oder des Lehrers darin, Schülerinnen und Schülern Lernarrangements anzubieten und deren selbst gestaltete Aneignungsprozesse als partnerschaftliche Ko-Konstrukteure zu begleiten.
Es ist sicher das Verdienst eines solchen Verständnisses von Lernen als Grundlage einer konstruktivistisch-systemisch orientierten Didaktik, den Stellenwert eigenaktiver Lern- und Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen deutlicher in den Blick der didaktischen Diskussion gerückt zu haben. Gleichwohl greift diese Sichtweise von Lernen und Unterricht zu kurz. Lernen und Entwicklung erfolgen bereits von Geburt an – dies zeigen die moderne Säuglingsforschung und neuere entwicklungspsychologische Erkenntnisse – nicht nur selbst-aktiv, sondern in Beziehung mit anderen für Kinder und Jugendliche interessanten, bedeutsamen Menschen. Zugleich sind kognitive Prozesse in umfassenderer und intensiverer Weise, als wir dies früher angenommen haben, mit Emotionen verbunden, wie in der »Affektlogik« von Ciompi zum Ausdruck kommt und in den zahlreichen entwicklungspsychologischen Veröffentlichungen von Greenspan et al. hervorgehoben wird. Gerade emotionale Erfahrungen machen Kinder mit Menschen ihrer Lebenswelt, ob in der Familie, im Kindergarten, in der Schule usw. Daher besteht Unterricht nicht nur darin, Lernangebote zu arrangieren und Lernprozesse (partnerschaftlich) zu begleiten. Vielmehr kommen der Lehrerin und dem Lehrer die Rolle und Aufgabe zu, den Schülerinnen und Schülern und mit ihnen die Welt in deren sächlichen, sozialen und normativen Dimensionen zu erschließen, an den Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen mit »interessierter Resonanz« (Schäfer) Anteil zu nehmen, aber auch mit „stimulierender Feinfühligkeit“ (Datler) Aktivitäten und Lernprozesse anzuregen.
Personenorientierung im Unterricht heißt also zum einen, sich als Lehrperson (und nicht nur als Lehrkraft), mit den Schülerinnen und Schülern in lehr-/lernstiftende Beziehungen zu treten. Personenorientierung heißt zum anderen auch, von der Lebenswelt der Schüler/innen, ihren Erfahrungen, Sinn- und Deutungsmustern im Unterricht auszugehen und – gerade bei Kindern und Jugendlichen aus belasteten Lebensverhältnissen – ihre (be-)drängenden Fragen und Probleme aufzugreifen.
Hier setzt das Konzept »Praktisches Lernen« an, das von Werner Bleher im ersten Beitrag vorgestellt und für den Unterricht im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung entfaltet wird. Der Autor legt die theoretischen Wurzeln und Begründungslinien dieses pädagogisch-didaktischen Konzepts und zugleich Schulreformkonzepts offen und skizziert dessen Merkmale wie z. B. Verbindung von Wissen, Handeln und Denken; Lebensdienlichkeit und Lebensbedeutsamkeit des Lernens, ohne Wissenschafts- und Fachorientierung aus dem Blick zu verlieren; selbsttätige Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit in deren Widerständigkeit; Verbindung von Kognition und Emotion. Am Beispiel des Unterrichtsvorhabens »Klassenzimmer als Lebensraum« in der achten Klasse einer Schule für Erziehungshilfe wird dargestellt, wie die Schüler/innen im »Praktischen Lernen« subjektiv sinnhafte, lebensweltbezogene Nützlichkeitserfahrungen machen, die ihrem Leben dienlich und identitätsfördernd sind.
Konsequente Orientierung des Unterrichts an Schülerinnen und Schülern mit Behinderung und ihrer Lebenswirklichkeit beinhaltet auch die Thematisierung ihrer Behinderungserfahrungen. Barbara Ortland geht in ihrem Aufsatz von autobiografischen Äußerungen körperbehinderter Menschen in der Literatur aus und bezieht sich auf das transaktionale Bewältigungsmodell von Lazarus und Folkman. Anschließend arbeitet sie überzeugend heraus, dass gerade Schüler/innen im Jugendalter als einer Zeit intensiver Selbstreflexion und Identitätssuche im Unterricht die Möglichkeit erhalten sollten, sich mit ihren Behinderungserfahrungen auseinanderzusetzen. Am Beispiel der Sexualerziehung, eines psychomotorischen Angebots und des Kunstunterrichts konkretisiert die Autorin Möglichkeiten eines Unterrichts mit dem Anspruch, Bewältigungsprozesse körperbehinderter Jugendlicher im Zusammenhang mit deren Behinderungserfahrungen zu unterstützen.
Neben Personenorientierung ist Fachorientierung eine zweite zentrale Bezugsgröße von Unterricht. Markieren beide ein Spannungsverhältnis, das möglicherweise in inklusiven Unterrichtskontexten an Intensität und Brisanz gewinnt (Fachorientierung bei Kindern ohne und Personenorientierung bei Kindern mit Behinderung)? Eine solche Aufspaltung wäre höchst problematisch. Hingegen spricht Vieles für die These, dass ein fundiertes Wissen um die jeweiligen fachdidaktischen Zusammenhänge, z. B. über den Aufbau schriftsprachlicher Kompetenzen, erst ermöglicht, Bedingungen und Stand der individuellen Aneignungsprozesse zu analysieren und im Unterricht zu berücksichtigen.
Die Bedeutung der Fachorientierung im Unterricht zeigt Christoph Ratz in seinem Beitrag am Beispiel des mathematischen Lernens bei Kindern mit geistiger Behinderung auf. Er arbeitet heraus, dass die Sachstruktur der Mathematik als »Wissenschaft von Mustern« Grundlage dafür ist, mit jedem Kind Unterrichtssituationen zu gestalten, die – auf welch basaler Ebene auch immer – seinem Entwicklungsstand entsprechen, ohne den »mathematischen Begründungszusammenhang« aufzugeben.
Ganz allgemein, besonders jedoch im inklusiven Unterricht wird es auf eine stärkere Verknüpfung fachdidaktischer Zusammenhänge mit den sonderpädagogischen Fachrichtungen ankommen.
Annette Leonhardt / Hans Weiß