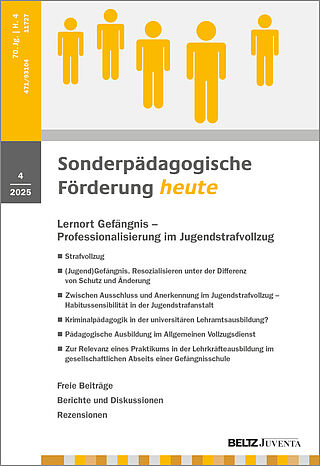- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Liebe Leserinnen und Leser,
Resilienz ist mittlerweile nicht nur in der Fachwelt, sondern auch in der Öffentlichkeit zu einem ‚Modebegriff’ avanciert, mit dem auch im (sonder-)pädagogischen Raum große Hoffnungen verbunden werden: Kindern und Jugendlichen in schwer belasteten und gefährdenden Lebenssituationen könne man in ihrer seelischen Widerstandsfähigkeit stärken, sodass sie – gleichsam immunisiert – mit widrigen Umständen leben lernen, sie bewältigen können, ohne gravierenden Schaden zu nehmen. In solchen Vorstellungen mischen sich Klischees und Mythen mit erfahrungsgestützten Einsichten. Wie Längsschnittstudien zeigen, können Kinder und Jugendliche in der Tat sehr belastende Lebensumstände halbwegs unbeschadet überstehen und daraus gestärkt für ihr weiteres Leben hervorgehen. Jedoch ist gleichzeitig zu betonen: Es gibt auch Umstände, unter denen kein Kind gedeihen kann.
Zu den Klischees gehört eine individualistische Sichtweise, die Resilienz mit einer allgemeinen Widerstandsfähigkeit gleichsetzt, über die ein Individuum durchgehend, also quasi als Persönlichkeitsmerkmal, verfüge. Diese könne gefördert, trainiert werden und unterscheide sogenannte »resiliente« von »nicht-resilienten« Personen. Das Ergebnis von Resilienzprozessen muss auch nicht der angepasste, der den alterspezifischen Normen konforme Heranwachsende sein. Vielmehr kann sich gerade auch in unangepasstem, »sperrigem« Verhalten Resilienz, Widerständigkeit ausdrücken, etwa wenn ein Kind auf aggressive, seine Umwelt störende Weise auf seine hoch belastete Lebenssituation aufmerksam zu machen sucht, im Unterschied zu einem Kind, dessen ‚Unauffälligkeit’ resignativer Ausdruck seiner desolaten Lebenssituation sein kann.
In den beiden Aufsätzen des Thementeils geht es – in je ganz unterschiedlicher Weise – darum, in der Gemengelage von Resilienz zwischen Mythos und Realität aufklärend zu wirken. Thomas von Freyberg und Angelika Wolff tun dies, indem sie auf Gefahren des Ressourcen- und des Resilienzansatzes aufmerksam machen: Mit der Rhetorik vom ‚kompetenten’ und ‚starken’ Kind würden die schweren Störungen und die innere Not von Kindern und Jugendlichen wie auch die sie (mit) bedingenden gesellschaftlichen Verhältnisse ausgeblendet, Resilienz als Mythos könne »strukturelle Verantwortungslosigkeit« (S. 141) kaschieren. Michael Fingerle erörtert empirisch gestützte Einwände gegen einen Resilienzansatz als »individuelle Fähigkeit oder Kapazität« (S. 127). Er plädiert dafür, in Anlehnung an den Kapitalbegriff von Bourdieu Resilienz als »Bewältigungskapital« (S. 127) zu betrachten. Voraussetzung für den Erwerb von Bewältigungskapital sind personale und soziale Ressourcen, über die ein Mensch verfügt und die er kennen und zu nutzen weiß, auch weil er bereits entsprechende ermutigende Erfahrungen gemacht hat.
Zwar weist das Resilienzkonzept nach wie vor offene Fragen auf. Gleichwohl hat die damit verbundene empirische Forschung einige wichtige Einsichten untermauert. Dazu gehört, dass Kinder und Jugendliche, die sich in belasteten Lebenssituationen als »widerständig« erweisen, oftmals über verlässliche Menschen verfügen, die für sie eine Halt gebende ›Ankerperson‹ darstellen und eine beratende, stützende, aber auch eine (heraus-)fordernde Mentorenrolle übernehmen. Die Forderung nach einer Kultur des Helfens und des Hilfeannehmens – in der Gesellschaft allgemein und speziell auch in den Bildungsinstitutionen – ist eine Konsequenz aus dem Resilienzkonzept. Dazu gehört nicht zuletzt eine »kindgerechte« und »fürsorgliche« Schule (Göppel), die Kindern Orientierung und Halt gibt, ihnen Ziele zumutet und sie ermutigt, ihre verfügbaren sozialen Ressourcen zu nutzen.
Christian Lindmeier / Hans Weiß