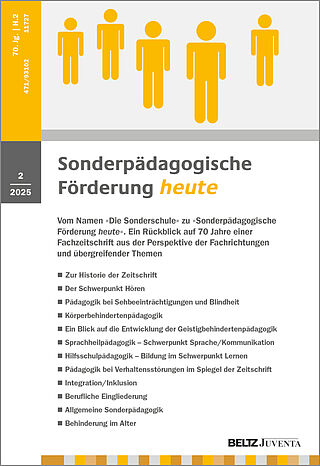- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit dem Schwerpunktthema »Professionalisierung des sonderpädagogischen Lehrerberufs« möchten wir im dritten Heft des Jahrgangs 2004 ein Thema präsentieren, das für viele Fachleute im Zentrum der Qualitätsentwicklung in der Schule steht.
Die Professionalitäts-Debatte, die seit den 1990er-Jahren in allen erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen verstärkt geführt wird und inzwischen auch die Sonderpädagogik erfasst hat (vgl. z.B. Loeken 2000; Rock 2001; Dlugosch 2003; Seemann 2003), »setzt [im schulischen Kontext, C.L.] mit modernen begrifflichen Mitteln die traditionsreiche Diskussion um die (dreifache) Frage nach dem eigentlichen Auftrag des Lehrers, nach seinem spezifischen Können zur Erfüllung dieses Auftrags sowie schließlich nach den Möglichkeiten der Ausbildung zur Vermittlung dieses Könnens fort« (Terhart 1995, 234). Dementsprechend wird die Professionalisierung von Lehrkräften an der Schnittstelle zwischen der individuellen Ebene des professionellen Selbst und der Lehrerpersönlichkeit und der kollektiven Ebene des gesellschaftlichen Auftrags und der staatlichen Kontrolle der Lehrerausbildung und der Berufsausübung von Lehrer(inne)n zu beschreiben und zu erklären sein.
Anders als in der Schulpädagogik gibt es allerdings in der Sonderpädagogik noch kaum empirische Forschungsstudien zur Lehrerprofessionalität. Deshalb finden Sie in diesem Heft vor allem theoretische Beiträge zur Lehrerprofessionalität von Sonderpädagog(inn)en. Dabei wird thematisch ein weiter Bogen von berufsethischen Aspekten bis hin zu psychologischen Fragen der Bewältigung von Belastungen im sonderpädagogischen Lehrerberuf gespannt. Drei der vier Beiträge stammen von Nachwuchswissenschaftler(inne)n, was als ein Indiz dafür gewertet werden kann, dass sich insbesondere die jüngere Generation von Fachleuten intensiv mit der Frage der Veränderung der sonderpädagogischen Berufsrolle auseinander setzt.
Der Beitrag »Stress im Lehrerberuf« von Rudolf Kretschmann ist dem Zweig der psychologischen Erforschung der Belastungen und Problembewältigungen im Lehrerberuf zuzuordnen. Diese Forschungsrichtung ist in der Sonderpädagogik insbesondere durch zahlreiche Fachartikel zu ›burnout‹ und ›burnout-Prophylaxe‹ bekannt geworden. Der Verfasser zeigt zunächst wesentliche Belastungen und Belastungsfolgen des Lehrerberufs auf, um anschließend darzulegen, wie berufstypischem Stress vorgebeugt und wie gesundheitsschädigende Belastungen reduziert werden können. Im Einzelnen werden dabei Möglichkeiten kollektiven wie individuellen stresspräventiven Handelns in der Schule vorgestellt. Als einziger Beitrag dieses Themenschwerpunkts kann er sich dabei unter anderem auch auf eigene empirische Untersuchungen stützen.
Michael Häußlers Artikel wählt einen anderen Zugang zur Professionalität sonderpädagogischen Handelns. Sein Thema ist die eigene moralische Haltung zum Beruf (Berufsethos), die er im Spannungsverhältnis von Ernst und Leichtigkeit angesiedelt sieht. Die zentrale These dieses berufsethischen Beitrags lautet, dass gerade durch das Ernstnehmen des anderen (Sorge um den Anderen) sowie der eigenen Person (Selbstsorge) die Gewinnung von Leichtigkeit in der sonderpädagogischen Förderung möglich ist. Diese These wird durch viele konkrete Beispiele aus der Schulpraxis des an einer Schule für Geistigbehinderte arbeitenden Verfassers veranschaulicht. Trotz der Fokussierung auf das professionelle Selbst des Sonderpädagogen/der Sonderpädagogin wird in Häußlers Text die kollektive Ebene des gesellschaftlichen Auftrags und der staatlichen Kontrolle der Lehrerausbildung und der Berufsausübung von Lehrer(inne)n nicht ausgespart.
Der Beitrag von Andrea Dlugosch gliedert sich in drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt geht es um das Verhältnis zwischen sonderpädagogischem Handeln und pädagogischer Professionalität. In diesem Zusammenhang wird die Figur professionellen Handelns unter Bezug auf aktuelle professionalisierungstheoretische Beiträge skizziert. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit professionellem sonderpädagogischen Handeln, setzt sich mit aktuellen Entwürfen zur sonderpädagogischen Professionalität kritisch auseinander und präsentiert den eigenen Standpunkt der Verfasserin. Im dritten Abschnitt geht sie der Frage nach, ob Fallverstehen lehrbar ist. Dabei erörtert sie auch andeutungsweise den Verstehensbegriff und die Frage der professionellen Reflexion.
Andreas Völkel unternimmt es in seinem Artikel, verantwortliches (sonder)pädagogisches Handeln als ein Handeln in Widersprüchen zu begründen. Für die verantwortliche Bearbeitung von strukturellen Widersprüchen im (sonder)pädagogischen Handlungsfeld werden von Völkel vier Ansatzpunkte (Widersprüche temporalisieren, Widersprüche reflektieren, Widersprüche transformieren, Widersprüche moderieren) herausgearbeitet, die zu einem vertieften Verständnis dieser (sonder-)pädagogischen Schlüsselkompetenz beitragen können.
Literatur
Dlugosch, A.: Professionelle Entwicklung und Biografie. Impulse für universitäre Bildungsprozesse im Kontext schulischer Erziehungshilfe. Bad Heilbrunn 2003
Loeken, H.: Erziehungshilfe in Kooperation. Professionelle und organisatorische Entwicklungen in ein er kooperativen Einrichtung von Schule und Jugendhilfe. Heidelberg 2000
Rock, K.: Sonderpädagogische Professionalität unter der Leitidee der Selbstbestimmung. Bad Heilbrunn 2001
Seemann, K.: Frühfördern als Beruf. Über die Entwicklung professionellen Handelns in Spannungsfeldern. Bad Heilbrunn 2003
Terhart, E.: Lehrerprofessionalität. In: Rolff, H.-G. (Hrsg.): Zukunftsfelder von Schulforschung. Weinheim 1995, 225–266