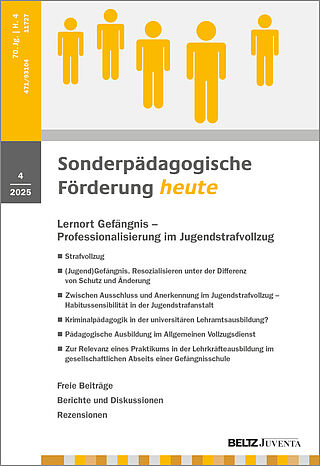- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
das vorliegende Heft mit dem Themenschwerpunkt ›Neue Aufgaben im Unterricht der Sonderschulen‹ nimmt sich Fragestellungen an, die aus theoretischer wie praktischer Sicht von großer Bedeutung sind. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen sich die sonderpädagogische Tätigkeit auf das Unterrichten herkömmlicher Lerninhalte konzentrieren konnte. Unmittelbar auf die Schüler bezogen, nehmen inzwischen diagnostische und beratende Tätigkeiten einen breiten Raum ein, verbunden mit Aufgaben, die sich auf das soziale Umfeld erstrecken und mitunter bis weit in das Feld der Sozialpädagogik hineinreichen. Im Unterricht selbst stellen Verhaltensprobleme Lehrerinnen und Lehrer vor einige Schwierigkeiten – im integrierten Unterricht ebenso wie in speziellen Einrichtungen, gleichermaßen im vor-, neben- und nachschulischen Bereich. Nicht zu Unrecht sprechen Ertle und Neidthardt von der Notwendigkeit einer ›situativen Didaktik‹, die es erfordert, sich immer wieder neu und in kreativer Weise auf unvorhersehbare Unterrichtssituationen einzustellen. Koordinierende Tätigkeiten zwischen verschiedenen Institutionen kommen hinzu, weiterhin eine Beteiligung an der Schulentwicklung. Damit ist ein differenziertes und anspruchsvolles sonderpädagogisches Tätigkeitsfeld umrissen, das hohe Anforderungen an diesen Beruf stellt und genau deshalb auch befriedigend wirken mag.
Zu den Veränderungen des Lehrerseins gehört auch, dass sich die Aufgaben des Unterrichts inhaltlich erweitern. Das hat zum einen damit zu tun, dass sich die Anforderungen der äußeren Realität wandeln. Medientechnische Kompetenzen, die vor wenigen Jahren nur einigen Experten zugänglich waren, gehören heute vielfach zu den unumgänglichen beruflichen Basisqualifikationen. Und fremdsprachliche Kenntnisse werden – um nur ein weiteres Beispiel zu nennen – sehr viel häufiger als zu früheren Zeiten erwartet, wenn nicht so gar vorausgesetzt. Hinzu kommen Aufgabenstellungen, die sich aus den sonderpädagogischen Fachdisziplinen ergeben. Sei es, dass neue Lehrinhalte bei einer speziellen Personengruppe nur schwer umsetzbar sind, oder auch, weil Behinderungen oder psycho-soziale Beeinträchtigungen von Schülern zu besonderen unterrichtlichen Themen führen.
An diesem Punkt setzen die Beiträge des Themenschwerpunkts an. Christoph Dönges plädiert dafür, dass die Umweltbildung auch bei der Unterrichtung behinderter und psychosozial beeinträchtigter SchülerInnen eine stärkere Beachtung finden soll. Dazu werden Entwicklungslinien, vorliegende Konzepte und der aktuelle Diskussionstand zur Umweltbildung dargestellt. Überlegungen zur Umsetzung bei Kindern und Jugendlichen, die unter erschwerten Lebenssituationen aufwachsen, schließen sich an. Nicht eine ›Sonderumweltbildung‹ ist das Ziel, sondern die sonderpädagogisch reflektierte Adaptation an eine spezielle innere und äußere Lebensrealität. Sandra Kutscher setzt sich mit dem Fremdsprachenlernen in der Sonderschule für Lernhilfe auseinander. Während das Fach Englisch in den meisten Bundesländern bereits in der Primarstufe an allgemeinen Schulen gelehrt wird, existieren dazu im Hinblick auf lernbehinderte Schüler kontroverse Standpunkte. Sie beziehen sich unter anderem auf die Belastbarkeit der Schüler und darauf, welche Lerninhalte vordringlich vermittelt werden sollen. Entsprechend regional unterschiedlich gestaltet sich die Schulpraxis. Die Autorin befürwortet das Erlernen einer Fremdsprache bei lernbehinderten Schülern aus Gründen, die sie ausführlich darlegt. Konsequenzen für die Unterrichtgestaltung werden anhand des aktuellen Kenntnisstandes zur Zweitsprachenerwerbsforschung, der Sprachlehr- und Lernforschung sowie der Fremdsprachendidaktik erläutert. Stefan Schabert beschäftigt sich mit speziellen Entwicklungsaufgaben, vor die körperbehinderte und auch geistig behinderte Schüler gestellt sind. Konkret geht es um die selbstbestimmte und selbstständige Bewältigung des Lebensalltages, um Selbstversorgung und Selbsterprobung, und die Frage, wie sonderpädagogisch fördernd und unterstützend gewirkt werden kann. Einschlägige theoretische Hintergründe werden erläutert, unter anderem durch Rückgriff auf das Empowerment-Konzept. Praktische Erfahrungen, die aus Unterrichtsprojekten stammen, schließen sich in ausführlicher Darstellung an.
Bernd Ahrbeck