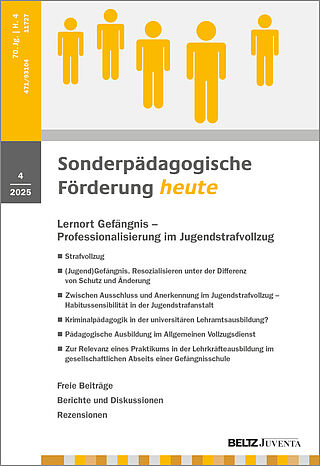- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
nachdem im zweiten Heft dieses Jahrgangs der Themenschwerpunkt »Qualitätssicherung« behandelt wurde, wollen wir mit diesem Heft eine Plattform für eine vertiefte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem eng verwandten Thema der Einführung von (Aus-)Bildungsstandards bieten. Die Frage nach der Standardisierung sonderpädagogischer Förderung muss nach bildungs- bzw. schulpolitischer Auffassung in zweierlei Hinsicht Antworten finden: Zum einen sollen in Analogie zu den z. T. bereits vorliegenden nationalen Bildungsstandards für einzelne Fächer (z. B. Deutsch) und Schul- bzw. Jahrgangsstufen (z. B. Primarstufe/3. Klasse) für das Lernen von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in verschiedenen Förderschwerpunkten (z. B. Lernen, Sprache, geistige Entwicklung) formuliert werden. Hierzu hat der Verband Sonderpädagogik e. V. im November 2007 »Standards der sonderpädagogischen Förderung« verabschiedet und im Heft 2/2008 der Zeitschrift für Heilpädagogik veröffentlicht. Zum anderen sollen Standards für die Lehrerbildung entwickelt werden, weil die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Bildung nach bildungs- bzw. schulpolitischer Auffassung ganz entscheidend von der Qualität der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern abhängt. Die KMK hat deshalb im Herbst 2007 eine Arbeitsgruppe zur Erstellung von Eckpunkten zur gegenseitigen Anerkennung von Studienabschlüssen aus lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengängen eingesetzt, die noch 2008 Mindestanforderungen im Hinblick auf die Ausbildung im sonderpädagogischen Lehramt in den jeweils relevanten Förderschwerpunkten vorlegen soll.
Beide Texte zur Standardisierung sonderpädagogischer Förderung werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Warum werden bspw. nur Mindeststandards bzw. Mindestanforderungen ausgearbeitet? Warum werden nur Standards für die Förderschwerpunkte und nicht für die allgemeinen und schwerpunktübergreifenden Inhalte des Lernens von Schülerinnen und Schülern und des Lehrens von Lehrerinnen und Lernern formuliert? Lässt sich sonderpädagogische Förderung überhaupt in ähnlicher Weise standardisieren wie die herkömmlichen Unterrichtsfächer oder liegt ihre Stärke gerade in der ›Nicht-Standardisierbarkeit‹ der individuellen pädagogischen Beurteilung und Förderung? Grundsätzlicher noch: Ist es nicht ein Kennzeichen allen pädagogischen Handelns, dass es nur in seinen routinisierbaren Anteilen standardisierbar ist, die nicht routinisierbaren, professionalisierungsbedürftigen Anteile aber den Kern der pädagogischen Handlungsstruktur bilden?
Diese und weitere wichtige und schwierige Fragen werden in den Beiträgen zum Themenschwerpunkt kritisch diskutiert. Einführend befasst sich Winfried Kronig mit grundlegenden Problemen einer Normierung von Bildung »zwischen Notwendigkeit und Unmöglichkeit«. In einer aus seiner Sicht »bemerkenswert unstandardisierten« Diskussion gelten Bildungsstandards als »Universalkonzept« gegen Ungerechtigkeiten in der Leistungsbeurteilung und für die bessere Vermittlung von Kompetenzen an Schülerinnen und Schüler sowie für die Qualitätsentwicklung von Schulen. Demgegenüber konturiert er problematische Nebenwirkungen von Bildungsstandards, indem Bildung auf mess- und testbare Leistungen eingeengt wird und Bildungsstandards der Objektivierung und Legitimation von Selektionsmaßnahmen dienen. Inwieweit solche unbeabsichtigten Nebenwirkungen oder doch beabsichtigte Wirkungen künftig dominieren werden, bedarf der kritischen Aufmerksamkeit gerade auch aus sonderpädagogischer Perspektive.
Demgegenüber kommt Franz B. Wember bei seiner vergleichenden Beurteilung der Chancen und Risiken von (Minimal-)Standards in der sonderpädagogischen Förderung zu einer insgesamt »positiven Einschätzung«. Auch er weist auf Gefahren einer outputorientierten Steuerung hin. Zugleich nennt er Schwierigkeiten der auf Mindeststandards bezogenen Beurteilung gerade der Förderergebnisse von behinderten Kindern und Jugendlichen, da sie nicht nur Adressaten, sondern Mitgestalter von Förderprozessen sind. Die für ihn überwiegenden Vorteile sieht er vor allem in einem Mehr an Transparenz in der Dokumentation von Bildungsergebnissen. Sie erleichtere es, die Effektivität und Effizienz von Förderung zu evaluieren und zu verbessern.
Ursula Stinkes stellt ihre dezidiert kritischen Erörterungen in einen weit gefassten Zusammenhang gesellschafts- und bildungspolitischer Entwicklungen. Im Wandel vom »fürsorgenden Staat« zum »aktivierenden Wohlfahrtsstaat« sieht sie eine Strategie, den Menschen im Sinne ihrer »Selbstregierung« (nach Foucault) mehr Vorantwortung und Kompetenzen zuzumuten. Dazu eigne sich ein »marktförmiges« Bildungssystem mit einer effizienten Output-Steuerung durch Kompetenz-Standards. Die sich daraus ergebende problematische Gleichsetzung von Kompetenzen, Standards und Bildung werde auch in der Sonderpädagogik favorisiert. Dies verlange ein Nachdenken über ein Bildungsverständnis, das jenseits hochgezogener Bildungsideale die Leiblichkeit des Menschen ernst nimmt und das von der Autorin abschließend umrisshaft entfaltet wird.
Ergänzt werden diese Aufsätze im Thementeil durch die Resolution der Konferenz der Lehrenden der Geistigbehindertenpädagogik an wissenschaftlichen Hochschulen in deutschsprachigen Ländern (KLGH) »zur Implementierung outputorientierter Bildungsstandards für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung«. Deren argumentative Hintergründe erläutert eine Autorengruppe in einem eigenen Beitrag. Sie fordern aus der Perspektive von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und insbesondere mit schwerer und mehrfacher Behinderung eine »Blickwendung«: »weg von einer Outputstandardisierung, hin zu der Frage nach Input- und Prozessqualität von Bildungsprozessen«. Sicher scheinen die Gefahren von Minimalstandards, vom schwer(st)behinderten Menschen aus betrachtet, am deutlichsten auf.
Christian Lindmeier / Hans Weiß