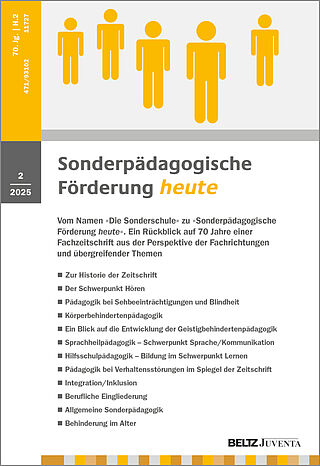- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Liebe Leserinnen und Leser,
das vorliegende Heft beschäftigt sich mit dem Schwerpunktthema »Mediale Nutzung und Medieneinsatz für Menschen mit Behinderung«. Die Anwendung technischer Medien ist zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Alltags geworden und auch aus dem Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen nicht mehr wegzudenken. Wie alltäglich der Umgang mit Medien geworden ist, zeigt der Beitrag von Markus Scholz. Während es ihm um die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung geht, wird im Artikel von Michae-la Nachtrab ein völlig anderer Aspekt der medialen Nutzung aufgezeigt: das Online-Schriftdolmetschen. Dieses ist eine Möglichkeit, Hörgeschädigte in der Kommunikation zu unterstützen – sei es bei einer integrativen (inklusiven) Beschulung, der Teilnahme an einer Weiterbildung oder zum Beispiel bei einem Behördengang. Das vorgestellte Online-Schriftdolmetsch-System befindet sich noch in der Entwicklung, erweist sich aber schon jetzt als ein sehr tragfähiges Konzept mit Perspektive. Den Themenschwerpunkt beschließt Lydia Dobler. Sie diskutiert Internetplattformen als Foren zur Selbsthilfe für Bulimikerinnen und Bulimiker und analysiert Möglichkeiten ebenso wie Gefahren.
Im allgemeinen Teil folgen zwei Beiträge aus internationaler Perspektive: Mit dem Beitrag von Gjert Langfeldt und Bernadette Hörmann wird das Eingangsstatement von Sieglind Ellger-Rüttgardt »Bildungspolitische Reform oder Revolution?« aufgegriffen. Die Autoren beschäftigen sich mit dem Verhältnis von »Didaktik und Inklusion« – einem Thema, dass in Folge der Behindertenrechtskonvention von großem Interesse ist. Aus pädagogischer Sicht erweist sich dabei der Paragraph 24 (so genannte »Bildungsparagraph«) der Konvention als zentral. Über seine schulische und vor allem unterrichtliche Umsetzung gilt es deshalb intensiv nachzudenken, so wie es Langfeldt und Hörmann aus skandinavischer Perspektive tun. Ihre Ausführungen dürften für unsere aktuelle Auseinandersetzung um »Inklusion« von be-sonderem Wert sein, gilt (galt?) Skandinavien doch bisher als Vorzeigemodell für Integration und Inklusion! International geht es weiter mit dem Beitrag von Kirsten Ludwig, die ein Beispiel für die Förderung von Kindern mit Legasthenie in Japan vorstellt.
Unser aktuelles Heft schließt mit den Ausführungen von Ulrike Fickler-Stang und Katharina Weiland. Sie erörtern die institutionelle Unterbringung schwieriger Jugendlicher in der ehemaligen DDR. Vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftspolitischen und wissenschaftlichen Debatte über den Umgang mit delinquenten beziehungsweise dissozialen Jugendlichen werden auch hier wichtige Impulse zu einer erneuten Reflexion gegeben.
Annette Leonhardt / Bernd Ahrbeck