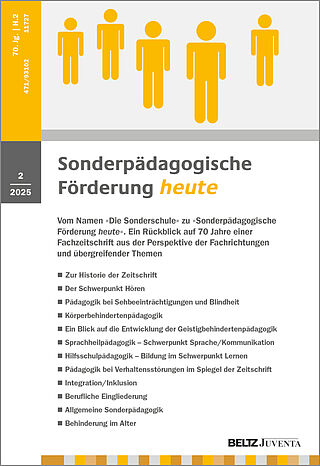- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Liebe Leserinnen und Leser,
Worte bilden die Wirklichkeit nicht nur ab, sie wirken auch auf diese ein. Ist es wirklich der ›Arbeitnehmer‹ - so kann man z. B. fragen -, der Arbeit nimmt? Oder gibt er sie nicht einschließlich seiner Arbeitskraft? Und nimmt nicht der ›Arbeitgeber‹ die Arbeitsleistung und Arbeitskraft des Arbeitenden (gegen Bezahlung)? Mit Geben und Nehmen sind unterschiedliche Konnotationen verbunden. Es ist in den gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Sprachspielen, die oft genug auch Machtspiele sind, nicht unerheblich, wer ›gibt‹ und wer ›nimmt‹, zumindest wer zu ›geben‹ vorgibt und wer zu ›nehmen‹ scheint.
Ein anderer Begriff, mit dem – nun schon aus dem pädagogischen und bildungspolitischen Kontext – Wirklichkeit beeinflusst und gestaltet wird, ist der Begriff ›Schulversagen‹. Im gängigen Sprachspiel wird er verstanden als Versagen eines Kindes in der Schule; in den Hintergrund tritt eine zweite Bedeutungsvariante: Schulversagen als Versagen der Schule an dem Kind. Im ersten Fall ist der Begriff eine einseitige Schuldzuordnung zulasten des Kindes und zur Entlastung der Schule.
Auch mit dem Begriff Bildung, der heute (wieder) im pädagogischen und politischen Kontext vielfach benutzt wird, verbinden sich unterschiedliche Konnotationen. Die Bezeichnung ›bildungsferne Schichten‹ hebt die Distanz der angesprochenen Menschen zur mittelschichtdominierten Bildung hervor und ist im Grunde eine arrogante (Dis-)Qualifizierung. Dass genau diese Form von Bildung, kanonisiert in Bildungsplänen, fernab steht von der Lebenswelt benachteiligter Menschen und ihren Bildungsbedürfnissen, kommt in diesem Sprachspiel nicht zum Ausdruck. Es unterstützt vielmehr die Vorstellung einer geforderten einseitigen Passung einer Gruppe von Menschen an ein von der Mehrheit geprägtes Bildungsideal, nicht auch die Passung dieses Bildungsideals in Richtung unterschiedlicher lebensweltorientierter Bildungsangebote.
Besonders die Frühe Bildung hat derzeit Hochkonjunktur, sowohl hinsichtlich konkreter Bemühungen um die Schaffung von zusätzlichen Krippen- und Kindergartenplätzen als auch auf der Ebene der Sprachspiele. Unterschiedliche Erwartungen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden damit verknüpft: die Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für junge Mütter, dadurch die möglichst effiziente Ausschöpfung ihres Humanvermögens im Sinne der Konkurrenzfähigkeit des ›Standorts D‹ sowie die Verbesserung der Bildungschancen für Kinder aus sog. ›bildungsfernen‹ Schichten. Diese Ziele stehen in einem Spannungsfeld, das der kritischen Reflexion bedarf, die jedoch unterbelichtet erscheint. So fällt auf, dass der Stellenwert von familiären Bildungsprozessen einerseits und institutionellen Bildungsprozessen andererseits und ihre – im Sinne nachhaltiger Bildungsprozesse – notwendige Verzahnung nicht hinreichend diskutiert werden. Diese Kombination von Erziehung, Bildung und Förderung in und mit der Familie und in den Einrichtungen, z. B. Kindertagesstätten, wäre besonders für Kinder aus soziokulturell benachteiligten Lebensverhältnissen wichtig.
Zu Recht wird die Bedeutung frühester Bildungsprozesse betont. Gemessen daran verwundert jedoch, dass bei Kindern und Jugendlichen mit schwerer Behinderung hingegen weniger von Bildung als von Förderung gesprochen wird. Unterstellt man ihnen doch nicht selbstverständlich Bildungsfähigkeit im Gegensatz zu kleinsten Kindern? Auch wenn das Entwicklungsalter, pädagogisch gesehen, nur eine begrenzte Aussagekraft für Bildungsprozesse hat, liegt das Entwicklungsalter vieler schwer behinderter Menschen nicht unter dem von Säuglingen und Kleinkindern. Dennoch ordnet man den einen selbstverständlich Bildung, den anderen häufig jedoch (nur) Förderung zu.
Weil Bildung ein gesellschaftlich hohes Gut darstellt, sind Bildungsdiskurse und damit verbundene Sprachspiele nicht frei von Machteinflüssen. Sie bestimmen wesentlich darüber, wer als ›gebildet‹ oder ›ungebildet‹, als ›bildungsfern‹ oder ›bildungsnah‹ gilt, und sie produzieren Gruppen nach Maßgabe von ›guter‹, weniger ›guter‹ und ›fehlender‹ Bildung. Daher ist es eine Herausforderung einer Pädagogik unter der Leitidee Inklusion, nicht-exklusive Bildung gerade Menschen anzubieten, die über keine oder wenig gesellschaftliche Macht und Geltung verfügen.
Dieses Heft stellt grundsätzliche Fragen an das Verständnis von Bildung innerhalb der (Sonder-)Pädagogik und an inklusionsorientierte (Aus-)Gestaltungsmöglichkeiten.
Gotthilf G. Hiller beschäftigt sich mit »Heterogenität – Ärgernis und Chance für die Schule« und plädiert für einen möglichst gerechten, pädagogisch qualifizierten Umgang mit Heterogenität, der Erfahrungen von Erfolglosigkeit, Demütigung und Ausgrenzung zu vermeiden sucht. Grundlage ist für ihn ein Bildungsverständnis, das, von der realen Lebenswelt soziokulturell und sozioökonomisch benachteiligter Schüler/innen ausgehend, diese ›fit fürs Leben‹ machen will.
Hans Weiß diskutiert Chancen und Probleme eines inklusiven Schulsystems im Blick auf Schüler/innen mit schweren Behinderungen. Ihn leitet die Frage, ob und unter welchen Bedingungen ein inklusives Setting den Bildungsbedürfnissen dieser Schüler/nnen gerecht werden kann
Wolfgang Jantzen setzt sich mit der Frage einer Bildung für alle auseinander und fasst diese als ein relationales psychosoziales System. Aspekte dieses Bildungsverständnisses sind die kategoriale Bildung, ein weit gefasster Entwicklungsbegriff, Dialog und Kooperation. Die Umsetzung erfordert ein spezifisches Selbstverständnis von den Lehrenden. Dies macht der Autor auch mit Bezügen zu neuropsychologischen Erkenntnissen und der Pädagogik der Befreiung von Paulo Freire deutlich.
Ursula Stinkes schließlich erörtert die Konzepte der Inklusiven Pädagogik und der Realitätsnahen Schule unter der Fragestellung, inwieweit sie die Bildung innewohnende Asymmetrie in ihrem Bildungsverständnis einlösen. Es zeigt sich, dass die beiden Konzepte hinsichtlich dieses Fokus nur scheinbar gegensätzlich sind. Der produktive Beitrag einer solchen Befragung liegt in der Neuproblematisierung eines Bildungsverständnisses für alle.
Die vier Beiträge des Thementeils spiegeln facettenreich die Komplexität der mit Bildung verbundenen Fragen und Probleme, Diskurse und Sprachspiele wider.
Ursula Stinkes / Hans Weiß