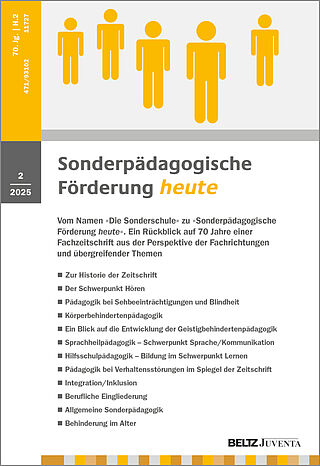- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Editorial
Unter der Fragestellung ›Von der Integration zur Inklusion?‹ sind im Thementeil dieses Heftes Beiträge zusammengefasst, die aus begrifflicher wie aus konzeptionell-praktischer Sicht eine Antwort suchen. Es wurden vor allem Kolleginnen und Kollegen um Beiträge gebeten, die sich bereits mit dieser Frage beschäftigt hatten; außerdem legten wir Wert darauf, dass die Beiträge eine international vergleichende Perspektive berücksichtigen und das schulische wie das außerschulische Handlungsfeld fokussieren.
Verfolgt man die Fachdiskussion der letzten Jahre, dann besteht Anlass zu der Vermutung, dass die international diskutierte Zielperspektive der ›inclusion‹ auch in Deutschland vor allem deswegen ins Gespräch gebracht wurde, weil es zu einer Stagnation der Integration in Deutschland gekommen ist (vgl. Reiser in diesem Heft). Die Berliner Erziehungswissenschaftlerin Anja Tervooren fasst das Unbehagen, das die Integrationspädagogik und der Integrationsbegriff in den letzten Jahren in Theorie und Praxis ausgelöst haben, treffend zusammen: »Die sich seit den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts etablierende Integrationspädagogik sah sich von Anfang an der Schwierigkeit ausgesetzt, dass sie, wollte sie einen vorhandenen Ausschluss rückgängig machen, diesen zuallererst anerkennen und mit seinen Kategorien und Bedingungen arbeiten musste. Bereits der Begriff ›Integration‹ impliziert ein spezifisches Spannungsverhältnis zwischen einer Gruppe, die integriert werden auf der einen und einer, die integrieren soll, auf der anderen Seite. Die Verwendung des Begriffs gibt demnach nicht nur eine Bewegungsrichtung, sondern darüber hinaus ein Verhältnis von Passivität und Aktivität der jeweiligen Gruppen vor. Durch diese Behauptung wird auf der Seite derjenigen, die integriert werden sollen, ein Defizit platziert, während die Notwendigkeit zur Intervention der anderen Gruppe angetragen und diese damit zur dominanten gemacht wird.« (2001, 206)
Um diese ›paradoxe Grundbedingung‹ der Integrationspädagogik zu überwinden, wurden bereits in den 1990er Jahren begriffliche Alternativen wie ›Nichtaussonderung‹, ›Nichtausgrenzung‹, ›gemeinsame Erziehung‹ oder ›Pädagogik der Vielfalt‹ vorgeschlagen. Der international immer einflussreicher werdende Begriff ›inclusion‹ bzw. der eingedeutschte Begriff ›Inklusion‹ kann als der aktuellste Versuch angesehen werden, dem geschilderten Problem entgegenzuwirken, das im Fachjargon als ›Zwei-Gruppen-Theorie‹ (vgl. die Beiträge von Sander und Hinz in diesem Heft) bezeichnet wird.
Die Entgegensetzung zweier Gruppen, die dem Begriff ›Integration‹ inhärent zu sein scheint, wirkt aber nicht nur an der Konstruktion eben dieser Gruppen mit, sondern hat auch auf der Ebene der Ausbildung von Sonder- bzw. Integrationspädagogen und Regelpädagogen Auswirkungen. Die Professionalisierung der Sonderpädagogen und der Regelpädagogen geht nach wie von dieser ›Zwei-Gruppen-Theorie‹ aus (vgl. Reiser in diesem Heft). Integrationsbezogene Ausbildungsinhalte konnten sich deshalb bestenfalls als Zusatzqualifikationen etablieren. Solange dies so bleibt, wird sich aber kein Wandel im Denken und Handeln vollziehen, wie er beispielsweise in dem neuen Positionspapier ›Inklusive Bildung‹ von ›Integration: Österreich‹ mit dem Begriff der Inklusion verbunden wird. Darin heißt es:
- »Während im Wort Integration eher ein ›Die Mehrheit integriert unter bestimmten Umständen eine besondere Minderheit‹ steckt, lässt Inklusion die Verschiedenheit im Gemeinsamen bestehen.
- Während Integration eher den an ein Defizit einer Person geknüpften Bedarf kennzeichnet (das ›I-Kind‹), betont der Begriff Inklusion die Notwendigkeit institutioneller und struktureller Veränderung und sieht die Verschiedenheit der einzelnen Menschen als einen positiven bereichernden Wert an.
- Während der Begriff Integration einen vorausgehenden Ausschluss aus den Leistungszusammenhängen der modernen Gesellschaft impliziert, geht es beim Inklusionsbegriff um die Mitbestimmung an der komplexen und differenzierten Gesellschaft.« (online unter www.ioe.at)
Die Notwendigkeit einer institutionellen und strukturellen Veränderung, die die Verschiedenheit und die besonderen Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen als einen ›positiven bereichernden Wert‹ ansieht, auf der einen Seite, und die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Veränderung in Richtung einer inklusiven Bürger- oder Zivilgesellschaft, die allen Mitgliedern vielfältige Partizipationsmöglichkeiten einräumt, auf der anderen Seite, wird in allen Beiträgen des Thementeils dieses Heftes herausgearbeitet. Während Helmut Reiser und Alfred Sander eher begriffs-, organisations- und professionalisierungstheoretische Überlegungen anstellen, zeigt der Beitrag von Andreas Hinz, dass die Frage nach Integration und Inklusion auch als theoretischer Reflex auf die Probleme der Praxisentwicklung verstanden werden kann. Zudem bietet er einen Überblick über die durch die Inklusionsbewegung angestoßenen Veränderungen in den einzelnen Praxisfeldern (Schule, Arbeit, Wohnen, Freizeit). Die Beiträge von Bettina Lindmeier und Florian Härle vertiefen diese praxisbezogenen Betrachtungen, in dem sie sich mit den Praxisfeldern des ›inklusiven‹ Wohnens und Lebens in der Gemeinde (Lindmeier) und der schulischen Inklusion (Haerle) näher beschäftigen. Beide Beiträge bedienen sich dabei einer international vergleichenden Perspektive. Bettina Lindmeier wählt diese Betrachtungsweise, um die innovative Argumentation des von den USA ausgehenden Handlungskonzepts des ›inclusive community living‹ nachzuzeichnen. Dabei wird die ›Zwei-Gruppen-Theorie‹, die im schulischen wie im außerschulischen Bereich mit einem meritorischen ›Tüchtigkeitsmodell‹ operiert, einer fundamentalen Kritik unterzogen. Als Lösungsansätze werden die Neukonturierung des Individuumbezugs durch personenbezogene Planung und systembezogene Innovationen durch eine sozialräumliche Unterstützungsplanung vorgestellt. Florian Härle referiert Forschungsergebnisse seiner qualitativen Studie über die inklusive Schulpraxis in dem australischen Bundesstaat New South Wales Dabei kann er zeigen, dass insbesondere die Curriculumentwicklung (curriculare Inklusion) und die Flexibilität und Vielfalt der Unterstützungsformen für das System Schule und die Lehrkräfte zu einem neuen Schulverständnis innerhalb des Schulsystems dieses Bundesstaates führten.
Mit der Fragestellung ›Von der Integration zur Inklusion?‹ lassen sich also Impulse für die von Stagnation bedrohte deutsche Integrationsbewegung und -pädagogik gewinnen, wenn in international vergleichender Perspektiven innovative Konzepte für einzelne Praxisfelder erschlossen werden. Außerdem schärft der ›Blick über den Zaun‹ das Bewusstsein für den notwendigen Perspektivenwechsel von einer personenzentrierten Erklärung von Exklusions- und Inklusionsprozessen hin zu einer auf das Bildungssystem fokussierten Betrachtungsweise.
Literatur
Tervooren, Anja: Pädagogik der Differenz oder differenzierte Pädagogik? Die Kategorie Behinderung als integraler Bestandteil von Bildung. In: Fritsche, B. et al. (Hrsg.): Dekonstruktive Pädagogik. Erziehungswissenschaftliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspektiven. Opladen 2001, 201–216