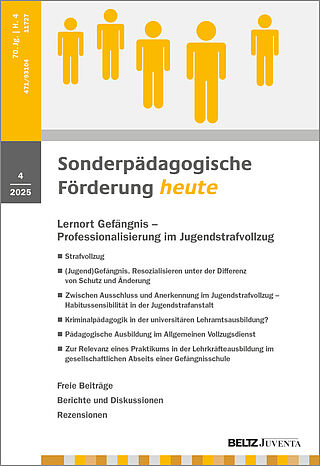- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Liebe Leserinnen und Leser,
Kommunikation ist im Vergleich zur Sprache sowohl in der Entwicklung des einzelnen Menschen als auch in der Millionen Jahre alten Menschheitsgeschichte nicht nur der umfassendere, sondern auch der früher entwickelte Bereich. Lange, bevor die menschliche Sprache vor ca. 500 000 Jahren auftauchte, konnten sich die Frühmenschen bereits verständigen. Ebenso beginnt Kommunikation als sozialer Austausch zwischen Mutter und Kind schon in der pränatalen Zeit: So kann die Mutter an der Bauchdecke erspüren, ob ihr Kind im Mutterleib aktiv ist, und durch Berühren ihres Bauches darauf ›antworten‹. Nach der Geburt wird dieser soziale Austausch durch die dem Baby verfügbaren mimischen, gestischen und anderen körperbezogenen Signale und unter Aktivierung des ›intuitiven Elternprogramms‹ der Mutter (verstanden als ›soziale Mutter‹) fortgesetzt und ausgeweitet. Dem Baby ist es möglich, die Mutter in ihren mimischen Äußerungen zu imitieren und damit zu ›belohnen‹; die Mutter greift emotionale Äußerungen, z. B. in Form kurzen Lächelns, auf und wiederholt dieses – variierend – mehrfach. Ihr Gesicht übernimmt dabei die Funktion eines emotionalen Spiegels. Dieser zeigt dem Kind, wie die Umwelt seine Affekte wahrnimmt und deutet (Affektspiegelung), und hilft ihm, sich allmählich seiner Gefühle bewusst zu werden.
Weitere wichtige Etappen in der Kommunikations- und Sprachentwicklung durchläuft das Kind, wenn es ab etwa einem halben Jahr beginnt, seine Aufmerksamkeit zwischen Gegenständen und Personen hin- und herpendeln zu lassen, und ihm ab etwa neun Monaten offenbar bewusst wird, dass derselbe Gegenstand auch von einer anderen Person wahrgenommen werden kann. Aus diesem als »sozialkognitive Revolution« bezeichneten Entwicklungsschritt (Bensel 2010, 31) entsteht mit 13 bis 15 Monaten die Zeigegeste, mit der das Kind das Interesse und die kommentierende Rückmeldung des Erwachsenen gewinnen kann. All diese wichtigen kommunikativen Entwicklungsschritte mithilfe vorsprachlicher Gesten schaffen beim Kind eine Struktur, auf der sich Lautsprache aufbaut (Bensel 2010, 32).
Die skizzierte Entwicklung setzt hinreichend gute Bedingungen in der Lebenswelt des Kindes, speziell im wechselseitigen Austausch zwischen Mutter (Eltern) und Kind, voraus. Hier aber zeigen sich deutliche Unterschiede, je nach der soziokulturellen Herkunft der Kinder. Auf der einen Seite lassen sozial besser gestellte, bildungsorientierte Eltern bereits ihren Kleinkindern alle möglichen kulturellen, besonders kommunikativ-sprachliche Anregungen zukommen – neuerdings bis hin zum sog. Babysigning, dem Gebrauch einfacher Handzeichen bzw. Gebärden zur Unterstützung der Kommunikations- und Sprachentwicklung. Auf der anderen Seite entbehren Babys und Kleinkinder aus soziokulturell belasteten Lebensverhältnissen kommunikativ-sprachlicher Anregungen bereits in ihrer frühen Entwicklung. Die Anregungsunterschiede setzen sich fort. So kamen nach einer US-amerikanischen Studie (vgl. Farah / Noble / Hart o. J.) Kinder mit niedrigem sozioökonomischem Status bis zum Eintritt in den Kindergarten auf durchschnittlich 25 Stunden, in denen Erwachsene in der Eins-zu-eins-Situation ein Bilderbuch mit ihnen anschauten, Kinder mit mittlerem sozioökonomischem Status hingegen auf 1000 bis 1700 Stunden.
Aber nicht nur sozial-kulturelle Faktoren spielen bei Erschwerungen der Kommunikations- und Sprachentwicklung eine zentrale Rolle, sondern auch schädigungs- bzw. behinderungsbedingte Ursachen. Welche Formen und Konzepte der speziellen Förderung und Unterstützung von Kommunikation und Sprache hier im sonderpädagogischen Kontext entwickelt worden sind, ist Gegenstand der drei Beiträge im Thementeil.
Hildegard Heidtmann befasst sich mit Entwicklung, Zielen, Zielgruppen, Kommunikationshilfen sowie möglichen Störungen im Prozess der Unterstützten Kommunikation mit Kindern, die im Erwerb der expressiven Lautsprache gravierende Probleme haben bzw. über diese nicht verfügen. Die Probleme dieser Kinder liegen nicht nur auf der Ebene der Artikulation, sondern schränken – so die Autorin – »die Verwirklichung kommunikativer Intentionen und die kommunikative Verständigung« (S. 354) gravierend ein. Daher versteht Heidtmann Unterstützte Kommunikation als einen Teil der Kommunikations- und Sprachtherapie – und nicht als eine eigenständige Disziplin. Vielleicht könnte eine solche professionsspezifische Verortung die theoretische Fundierung der Unterstützten Kommunikation weiter voranbringen.
Für den Schriftspracherwerbsprozess von Kindern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, einen zentralen Bereich kommunikativ-sprachlicher Bildung und Förderung, betont Ellen Schwarzburg-von Wedel die Bedeutung, die der Vermittlung kultureller Produktionen in Worten, Sätzen und Texten an die Schüler/innen zukommt. Damit wird der Stellenwert ihrer eigenaktiven Auseinandersetzung mit Sprache und Schrift keineswegs herabgesetzt, wohl aber wird die Relevanz der intersubjektiven Dimension in der Erschließung vorgegebener Kulturgüter als Aufgabe von Unterricht und darin stattfindender Bildungsprozesse in ein angemessenes Licht gerückt.
Ausgehend vom Verhältnis Kommunikation, Sprache und Kognition betrachtet schließlich Klaus-B. Günther Gebärden-, Schrift- und Lautsprache als integrierende bilinguale Förderansätze für gehörlose und hochgradig schwerhörige Kinder. Er sieht darin eine Möglichkeit, Störungskorrelate in der Kommunikation und Kognition zu minimieren, und spricht sich zugleich für frühe bilinguale Kommunikationserfahrungen für diese Kinder aus.
Annette Leonhardt / Hans Weiß
Literatur
Bensel, J. (2010): Frühe nonverbale Kommunikation des Babys. In: Fiduz 13, Nr. 25, 30–32.
Farah, M. J. / Noble K. G. / Hurt, H. (o. J.): Poverty, privilege, and brain development: empirical findings and ethical implications. [http://www.psych.upenn.edu/~mfarah/farah_SES_05.pdf; entnommen am 14.09.2010].