- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychotherapie & Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
- Psychotherapie & Psychologie
- Veranstaltungen
- Prof. Dr. med. Alexandra Philipsen über »ADHS bei Erwachsenen: Der aktuelle Stand zu Diagnostik, ICD-11, Psychotherapie und Medikation«
Prof. Dr. med. Alexandra Philipsen über »ADHS bei Erwachsenen: Der aktuelle Stand zu Diagnostik, ICD-11, Psychotherapie und Medikation«
Zum Format:
- Zoom
- Dauer: 1,5 Std.
- Teilnahmezertifikat mit 2 Fortbildungspunkten
- Kosten: 49 € (inkl. MwSt.)
Zum Inhalt der Veranstaltung:
- Diagnostik nach S3-Leitlinien
- Neuerungen durch die ICD-11
- Grundpfeiler der Therapie: Psychoedukation, Verhaltensänderung, psychosoziale Aspekte und Medikation
Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine häufige Entwicklungsstörung, die nicht auf das Kindesalter begrenzt ist. Bis zu 70% der diagnostizierten Kinder weisen auch im Erwachsenenalter noch ADHS-Symptome und/oder funktionelle Beeinträchtigungen auf. Für die Diagnostik und Behandlung liegen evidenz-basierte S3-Leitlinien vor. ADHS ist gehäuft mit weiteren psychischen und somatischen Erkrankungen assoziiert und stellt einen Risikofaktor für ungünstige psychosoziale Folgen einschließlich verfrühter Mortalität dar. Bis zu 80% der phänotypischen Varianz lassen sich auf genetische Faktoren und ihre Interaktion mit Umweltfaktoren zurückführen.
Im Vortrag wird neben den wissenschaftlichen Grundlagen der State of the Art der Diagnostik und Therapie anschaulich dargestellt.
Die Diagnostik umfasst eine gründliche klinische Differentialdiagnostik, strukturierte Interviews und Fragebögen sowie eine Fremdanamnese. Das Behandlungskonzept basiert neben einer ausführlichen Psychoedukation wesentlich auf einer medikamentösen Behandlung und bezieht psychosoziale und vorrangig kognitiv-behaviorale Therapien mit ein. Beides wird im Vortrag anschaulich dargestellt. Im Anschluss an den Vortrag beantwortert Prof. Philipsen Ihre Fragen, die Sie über den Chat stellen können.
Das Online-Seminar kann nach individuellen Wünschen der Teilnehmer:innen zudem ergänzt werden um spezifische psychodynamische Konzepte.
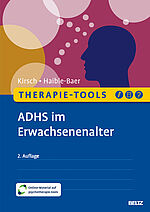
Passender Buchtitel zum Webinar:
ADHS ist auch bei Erwachsenen ein Problem: Zwei Drittel der Betroffenen, die schon als Kind eine Aufmerksamkeitsstörung hatten, haben sie auch noch im Erwachsenenalter. Etwa 3% der Erwachsenen in Deutschland sind davon betroffen. Sie leiden unter Schusseligkeit, Impulsivität und Ablenkbarkeit, für viele ist eine Psychotherapie nach wie vor hilfreich.
In dem Therapie-Tools-Band haben die Autor_innen über 160 Arbeitsmaterialien zu den wichtigsten Behandlungsmethoden aus der Kognitiven Verhaltenstherapie, der Emotionsregulation, achtsamkeitsbasierte Methoden und vieles mehr zusammengetragen. »Lebenspraktische« Interventionen runden das Ganze ab. So bekommen die Betroffenen wieder mehr Struktur in ihr Leben.